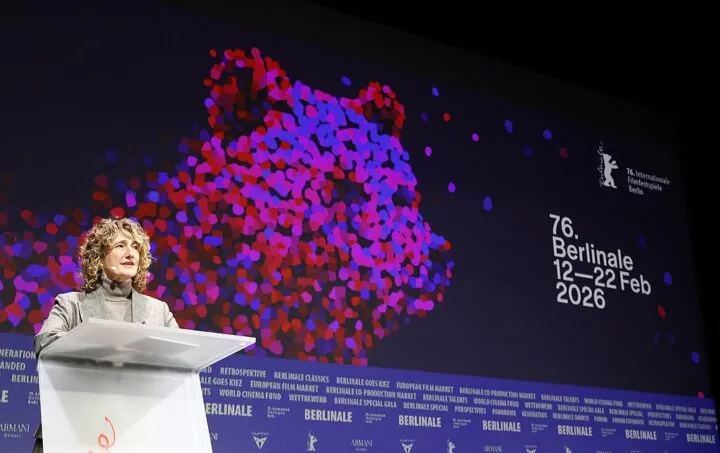Offen und gerecht!
Fragen zum Umgang mit Digitalisaten von Objekten aus Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten (Teil 4)

Isabel Fischer
Anna Brus
Lisa Marei Schmidt
Michael Höppe
3. August 2022
Als Einleitung möchten wir die einzelnen Personen, die die Fragen beantworten, kurz vorstellen. Sagen Sie uns bitte, wie Sie zum Projekt „Digitalisierung der Ethnographica-Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff“ gekommen sind und welche Aufgaben Sie in Bezug auf dieses Projekt bzw. die Ausstellung „Whose Expression“ übernommen haben.
Lisa Marei Schmidt: Ich bin seit Oktober 2017 Direktorin des Brücke-Museums und in dieser Funktion letztlich auch verantwortlich für den Nachlass des Künstlers Karl Schmidt-Rottluff, der das Museum initiiert hat. Mir war die Aufarbeitung des Bestandes von Werken aus kolonialen Kontexten von Anfang an ein besonderes Anliegen. Und mir war sehr bewusst, dass wir bei der Digitalisierung komplett anders vorgehen müssen als bei der Digitalisierung von Kunstwerken der klassischen Moderne, unserem Kerngeschäft. Dies betrifft vor allem die Dezentralisierung und Infragestellung einer Wissenshierarchie.
Isabel Fischer: Ich habe die Koordination für das Projekt übernommen. Zu meinen Aufgaben gehörten die Koordination von und Kommunikation mit allen Projektbeteiligten, die Entwicklung und Anpassung des Work-Flows sowie die Überwachung des Zeit- und Finanzplans und die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe bereits vorher sammlungsbezogene Digitalisierungsprojekte des Brücke-Museums betreut, doch dieses war mit Abstand das herausforderndste und spannendste, nicht zuletzt, weil es einen dazu brachte, sich beständig selbst zu hinterfragen.
Anna Brus: Ich habe schon vorab zu kolonialen Sammlungen gearbeitet und fand als Kunsthistorikerin die Verbindung dieser Sammlung zu der Künstlergruppe Brücke spannend. Hier kommen ja zwei sonst meist getrennt gehaltene Museumsgeschichten, aber auch Kunstformen zusammen – und es hat mich interessiert, was wir über Kolonialität, Kunst und Gesellschaft lernen können, wenn wir diese beiden Bereiche zusammenbringen.
In dem Projekt war ich vor allem für die Netzwerk-Arbeit zuständig. Meine Aufgabe war es, die Objekt-Subjekte in der Sammlung in Rücksprache mit verschiedenen Expert*innen zu kontextualisieren, ihnen eine Herkunftsregion, einen Herstellungszeitraum und mögliche Funktionen zuzuordnen.
Michael Höppe: Meine Aufgabe im Projekt war die Datenkuration und damit das Mapping der Daten sowie ihre Integration in Wikimedia Commons.
Erzählen Sie uns etwas über die Digitalisierung der Ethnographica-Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff. Wie kam es dazu? Mit welchem Ziel wurde ein Großteil der Digitalisate auf Wikimedia Commons veröffentlicht? Welche Hoffnungen und Bedenken waren im Vorfeld damit verknüpft?
Lisa Marei Schmidt: Für mich stand die Transparentmachung dieses Bestandes im Vordergrund, zu zeigen, was wir in unserem Depot aufbewahren. Die Sichtbarmachung dieser Werke beinhaltet nicht zuletzt auch das Potential für eine mögliche Restitution.
Isabel Fischer: Das Ziel des Projektes war einem größtmöglichen (internationalen) Rezipient*innenkreis größtmögliche Teilhabe an der Sammlung zu ermöglichen. Partizipation sollte im Optimalfall auf zwei Ebenen erfolgen: Einmal im Prozess der Grunderschließung, die in enger Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den Herkunftsgesellschaften und dekolonialen Akteur*innen erfolgte und dann durch die Wahl der Veröffentlichungsplattform Wikimedia Commons, in der die Daten nicht festgeschrieben sind, sondern von anderen erweitert werden können. Die Hoffnung war, die Daten damit für alle Interessierten barrierearm verfügbar, nutzbar und editierbar zu machen. Ein Bedenken war, dass die Projektlaufzeit von nur einem Jahr nicht ausreichen würde. Ein anderes Bedenken war, nicht genug Menschen, insbesondere Expert*innen aus den Herkunftsgesellschaften zur Mitarbeit an dem Projekt gewinnen zu können.
Welche weiteren Herausforderungen stellten sich während der Digitalisierung und Veröffentlichung, etwa in Bezug auf Feststellung der Provenienz/Herkunft, der Digitalisierung oder auch der Beschreibung der Objekte (Stichwort Metadaten)?
Anna Brus: Es ging ja darum, die Objekte zu kategorisieren, aber das vorhandene Wissen zur Herkunft von kolonialzeitlichen Objekten trägt meist nicht weit. Es ist häufig ein Wissen, das daraus resultiert, dass Forscher*innen auf eine gemeinsame Quelle zurückgreifen, oder immer wieder neu aufeinander Bezug nehmen oder schlicht und einfach voneinander abschreiben. Diese dünne Quellenlage betrifft leider auch meine eigene Arbeit für das Projekt. Angesichts so vager Wissensbestände steht man vor der Entscheidung, so gut wie gar nichts zu schreiben oder ungesichertes Wissen festzuhalten. Denn auch ungesichertes Wissen kann helfen, eine Spur zu legen, so dass vage Angaben das Finden von Objekten erleichtern kann, wenn sie Teil von Suchkriterien werden.
Eine andere Herausforderung betrifft die Wahl unserer Wissensformen und der Plattformen, auf denen wir Wissen zugänglich machen. Wir müssen uns fragen, ob Plattformen wie Wikimedia Commons für alle Menschen, überall, so einfach zugänglich sind. Außerdem liegt das Wissen dadurch weiter im globalen Norden. Die Frage bleibt, wie können die Daten auch bei den sogenannten Herkunftsgesellschaften verwaltet werden?
Noch grundsätzlicher entsteht das Problem eines Clashs von Wissensformen. Die Klassifikationen der europäischen Wissensgeschichte sind eben nicht notwendig deckungsgleich mit Klassifikationen der Gruppen, die sich für diese Objekte bis heute verantwortlich fühlen, und wo es häufig auch um emotionales Wissen und lokal spezifische Erinnerungsformen geht. Nicht zuletzt ist in europäischen „ethnologischen“ Repräsentationen auch die problematische „tribale“ Klassifikation und die koloniale Gewalt der Sammeltätigkeit eingeschrieben, ohne explizit darauf hinzuweisen.
Michael Höppe: Eine Herausforderung in meinem Arbeitsbereich war die Verwendung von kontrollierten Vokabularen, d. h. die Verwendung von Begrifflichkeiten aus einem gängigen Wortschatz. So mussten spezielle (Fach-)Bezeichnungen verallgemeinert (bspw. bei dem Material eines Objekts) oder Begriffe aus anderen Kontexten herangezogen werden. Nicht immer ließen sich Herkunftskontexte der Werke adäquat abbilden. Schwierig gestaltete es sich z. B., wenn sich diese nicht auf einen festen Ort, sondern auf eine Bevölkerungsgruppe, die sich über verschiedene Regionen verteilt, bezogen (Lösung war hier z. B. die Verknüpfung mit einem Sprachraum).
Isabel Fischer: Bei der Digitalisierung selbst war die Herausforderung Digitalisate zu erhalten, die das Werk in seiner vollständigen Charakteristik wiedergeben. Dies bedeutete zum einen, dass pro Werk mehrere Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven erfolgen mussten. Auf der anderen Seite musste eine Technik gefunden werden, die das jeweilige Werk auf allen Bild-Ebenen gleichmäßig scharf darstellt. Eine weitere Herausforderung war es, flexibel im Zeitplan und Workflow zu bleiben und diese immer wieder neu anzupassen, etwa wenn bestimmte Gesprächspartner*innen nicht erreichbar waren oder sich bei der Grundauswertung weitere Fragen ergaben.
In Offen und gerecht! Fragen zum Umgang mit Digitalisaten von Objekten aus Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten (Teil 2) haben wir Juma Ondeng, den Projektpartner des IIP u. a. gefragt, ob es Objekte (folglich auch Digitalisate) gibt, die nicht öffentlich geteilt werden sollten. Haben Sie alle Digitalisate der Ethnographica-Sammlung online veröffentlicht? Welche vielleicht nicht und wie haben Sie diese Entscheidungen getroffen?
Anna Brus: Wir haben nur einen kleinen Teil nicht veröffentlicht, dabei handelt es sich um mesoamerikanische Grabbeigaben, die ansonsten in vielen musealen und privaten Sammlungen sichtbar sind. Die Gespräche mit Expert*innen aus der Oaxaca-Community, die als Nachfahren dieser Kulturen verstanden werden können, haben nahegelegt, diese Sammlungsbestände mit besonderer Pietät zu behandeln. Es handelt sich um sehr persönliche Dinge, die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg mitgegeben wurden. Was „sensible Objekte“ sind, liegt nicht unbedingt in unserem Ermessen und lässt sich nicht pauschal festlegen.
Diese Community würde übrigens generell lieber die Weitergabe von Bildern mit Objekten- oder Subjekt-Objekten indigener Herkunft aus Abya Yala kontrollieren. Hier sieht man auch die Probleme, die die absolute Transparenz und Freigabe der Bildrechte über Wikimedia Commons mit sich bringt.
Welche Verantwortung könnten/sollten Ihrer Meinung nach Museen gegenüber den ursprünglichen Eigentümer*innen der Objekte in ihren Sammlungen haben?
Anna Brus: Diese Form der Zusammenarbeit mit Communities ist meist nur vorübergehend und, auch wenn sie bezahlt wird, eine Form, Wissen und auch emotionale Arbeit zu extrahieren. Meines Erachtens sollten Museen, wenn sie schon Kontakte aufbauen, diese langfristig gestalten und über dauerhafte Kooperationen und Restitutionen nachdenken.
Im Grunde genommen müsste eine Digitalisierung auch den Aufbau einer Infrastruktur an den Orten der betroffenen Herkunftsgesellschaften mit sich bringen. Es gibt zum Beispiel in Papua-Neuguinea, woher ein großer Teil der Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff stammt, nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, einen öffentlichen Rechner zu nutzen. Das Herunterladen von hohen Datensätzen auf das Handy kostet viel zu viel Datenvolumen. De facto geht hier also die Transparenz manchmal ins Leere …
Können Sie etwas mehr über die Auswirkungen des Digitalisierungsprojektes im Brücke-Museum sagen? Wie wurden sie intern wahrgenommen? Wie wurden die Ausstellungen vom Publikum aufgenommen?
Lisa Marei Schmidt: Das Brücke-Museum setzte sich 2021 in mehreren Projekten mit seinem kolonialen Erbe auseinander. Neben dem Digitalisierungsprojekt beschäftigten sich auch die beiden Ausstellungen „Whose Expression?“ und „Transition Exhibition“ sowie ein internes Sensibilisierungs- und Fortbildungsprogramm mit diesem Themenkomplex. „Whose Expression“ befragte die Werke der Brücke-Künstler vor dem Hintergrund des Kolonialismus. Und in der Ausstellung „Transition Exhibition“ wurde der digitalisierte Bestand an Werken aus kolonialem Kontext aus dem Nachlass des Künstlers Karl Schmidt-Rottluff zum ersten Mal komplett ausgestellt und von zeitgenössischen künstlerischen Positionen kritisch befragt. Besonders schön war es für alle Mitarbeitenden zu sehen, wie sich Synergieeffekte zwischen den unterschiedlichen Projekten ergaben. Dabei flossen ebenso Ergebnisse aus dem Digitalisierungsprojekt in die Ausstellung ein wie umgekehrt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ein Großteil des Publikums von den Ausstellungen und den kritischen Ansätzen sehr angetan war. Die Projekte bekamen ein großes Medienecho und wurden intensiv diskutiert. Darunter waren auch kritische Stimmen, die uns eine übertriebene „political correctness“ vorwarfen und die Brücke-Künstler diffamiert sahen. Letztlich hoffen wir aber mit den Projekten bei vielen das Bewusstsein für die kolonialen Kontexte, die uns bis heute begleiten, geweckt zu haben.
Isabel Fischer: Das Digitalisierungsprojekt wurde sowohl intern als auch extern weitgehend sehr positiv aufgenommen. Es wurde auf mehreren Fachtagungen vorgestellt und stieß dort auf großes Interesse. Vor allem die Entscheidungen, mit Expert*innen aus den Herkunftsgesellschaften zusammenzuarbeiten und die Daten über Wikimedia Commons zu veröffentlichen, und damit die institutionelle Deutungshoheit abzugeben, erhielten positives Feedback.
Wie geht es nach dem Ende des Digitalisierungsprojektes und der Sonderausstellung “Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext” weiter? Besteht der Austausch mit Expert*innen aus den Herkunftsgesellschaften weiterhin?
Lisa Marei Schmidt: Mir war sehr bewusst, dass die Ausstellungen am 20. März 2022 enden, aber dass uns das Digitalisierungsprojekt noch die nächsten Jahre beschäftigen wird, gerade was die Erforschung der Provenienzen der Werke angeht. Glücklicherweise hat unsere wissenschaftliche Projektmitarbeiterin Anna Brus vom Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste einen Drittmittelantrag zur Erforschung der Provenienzen dieser und anderer Sammlungen der Brücke-Künstler und deren Umkreis zugesagt bekommen. Dadurch kann der von ihr mühsam aufgebaute und auf Vertrauen basierende Austausch mit den Expert*innen der Herkunftsgesellschaften weitergehen.
Isabel Fischer: Das Brücke-Museum wird die Wikimedia-Commons-Projekt-Seite weiter monitoren. Außerdem ist geplant, die Werkdaten in Wikidata zu überführen und diese mit den Wikimedia-Commons-Mediendateien zu verknüpfen.
Was sind Ihre persönlichen Lehren und Erfahrungen aus dem Projekt?
Lisa Marei Schmidt: Vielleicht den Mut zu haben, das Fragenstellen öffentlich zu machen und nicht seine fehlende Expertise als Vorwand zu verwenden, dass man nicht beginnen kann, sondern dass man das Fragenstellen und das Öffnen für andere Antworten und Perspektiven als Bestandteil des Prozesses begreift. Und dass die Zusammenarbeit mit Expert*innen als langfristige und vor allem für beide Seiten wertschätzende Kooperationen verstanden werden müssen, die nachhaltig sind und auch honoriert werden.
Isabel Fischer: Meine größte persönliche Lehre ist die Bereitschaft für größtmögliche Flexibilität. Anders als andere Digitalisierungsprojekte erforderte dieses ein beständiges Hinterfragen der eigenen Arbeitsprozesse und Planungen. Der Zeitplan und einzelne Arbeitspakete mussten immer wieder neu gedacht und angepasst werden. Das bedeutete auch Abstand von der Vorstellung zu entwickeln, dass so schnell wie möglich Wissen um die Werke generiert und veröffentlicht wird.
Anna Brus: Wir können nicht mehr „über die Anderen“ forschen, sondern nur noch im Austausch. In der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen gab es für mich immer wieder überraschende Ergebnisse, die ich nicht hätte vorhersehen können. Deswegen ist es wichtig, immer wieder die Mühe der Kooperation auf sich zu nehmen – und dabei offen für alle möglichen Entwicklungen zu bleiben.
Gibt es Pläne, die in Bezug auf das Projekt gesammelten Erfahrungen/Learnings in einem größeren nationalen und internationalen Netzwerk von Museen und anderen Institutionen zu teilen, um so vielleicht gemeinsam nachhaltige Lösungen zu erarbeiten?
Isabel Fischer: Das Brücke-Museum plant in Zusammenarbeit mit digiS einen Erfahrungsbericht zu veröffentlichen, um die Voraussetzungen und Learnings eines solchen Projektes mit anderen Institutionen zu teilen.
Welche Rolle könnten Ihrer Meinung nach Wikimedia-Projekte bei der Digitalisierung des kulturellen Erbes, insbesondere bei Sammlungen aus kolonialen Kontexten, wie zum Beispiel der Ethnographica-Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff, spielen?
Isabel Fischer: Wir waren sehr froh, dass uns digiS den Kontakt zu Wikimedia Deutschland vermittelt hat und wir noch vor der ersten Datenveröffentlichung einen engen Austausch hatten. Besonders gefreut hat uns auch die praktische Unterstützung (etwa in Form einer Beratung bezüglich der Verwendung von Templates durch das Wikimedia-Community-Mitglied Raimond Spekking). Viele Kulturinstitutionen denken vermutlich überhaupt nicht daran, dass sie ihre Daten auch über Wikimedia Commons oder Wikidata veröffentlichen könnten. Von daher wäre eine noch stärkere Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit von Wikimedia sinnvoll, vielleicht auch eine direkte Kontaktaufnahme mit Kulturinstitutionen. Hilfreich wäre außerdem eine stärkere Mobilisierung der Wiki-Community, sie auf solche Projekte und Veröffentlichungen aufmerksam zu machen.
Wie müssten sich Politik/Gesetze/Voraussetzungen ändern, um mehr Museen bei dieser Arbeit und ähnlichen Projekten wie Ihrem zu unterstützen?
Lisa Marei Schmidt: Die intensive Aufarbeitung eines solchen Konvoluts, gerade was die Provenienzen angeht, ist nur durch längerfristige Drittmittelprojekte möglich.
Anna Brus: Erstmal geht es darum, Museen finanziell zu unterstützen, bzw. überhaupt erst ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass Sammlungen aus kolonialem Kontext eine besondere gesellschaftliche Verantwortung mit sich bringen. Diese Frage ist aber viel fundamentaler, denn wir können uns nicht allein „dekolonisieren“. Es ist ein langer Prozess, die Kolonialität unserer Episteme, unserer Objektkategorien und Hierarchisierungen zu erkennen und die Sammlungen daraus zu lösen. Um in diesem Bereich sinnvoll arbeiten zu können, sind wir auch von Kooperationen mit Kolleg*innen aus dem sogenannten „Globalen Süden“ abhängig. Es gibt trotz zahlreicher transnationaler Förderprogramme noch immer nationale Grenzziehungen, mangelnde Anerkennung von akademischen Qualifikationen oder Visaregelungen, die eine solche Zusammenarbeit erschweren.
Interview & Redaktion: Sabine Müller, Lucy Patterson, Claudia Bergmann
Weitere Teile dieser Blogserie: