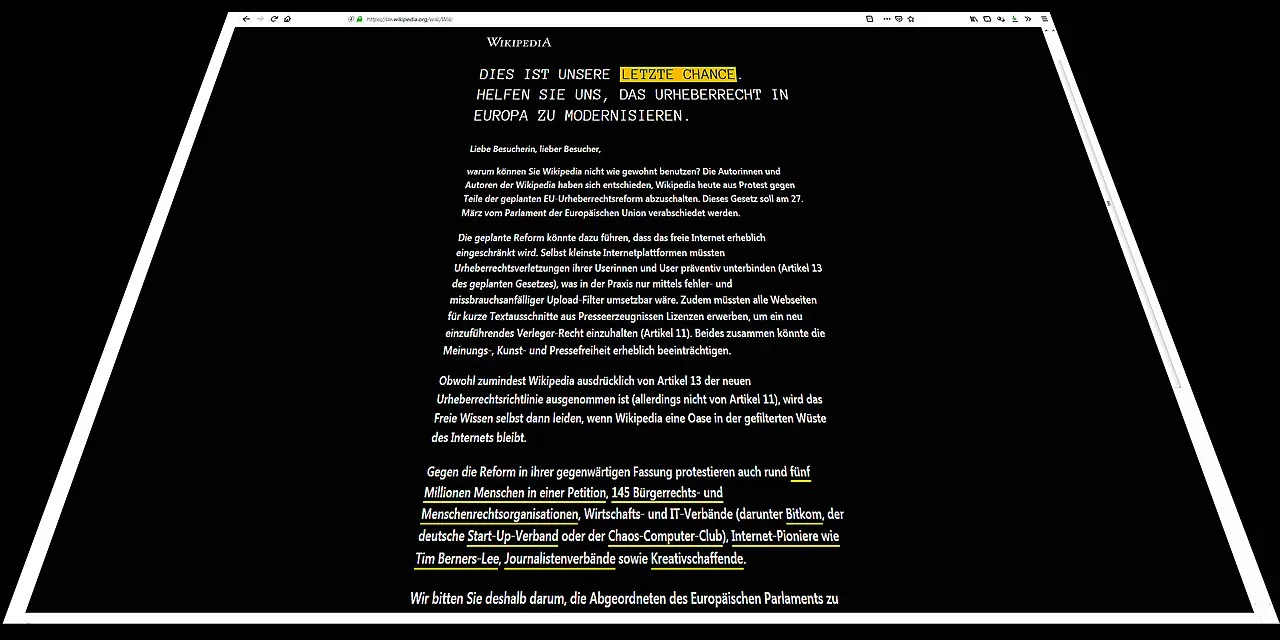20 Jahre für ein besseres Internet
Europawahl: Der Digital-O-Mat feiert Geburtstag


Franziska Kelch
5. Juni 2024
Erstmals konnten Wählende den Digital-O-Mat zur Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen nutzen. Die Menschen in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland konnten damit Abweichungen und Übereinstimmungen zwischen den eigenen Positionen und denen der Parteien überprüfen. Im Gegensatz zum Wahl-O-Mat liegt der Fokus auf Fragen rund um Digitales und Freies Wissen.
Jeder Digital-O-Mat ist anders
Zu welchen Fragen Wählende im jeweiligen Digital-O-Mat die Positionen der Parteien mit den eigenen abgleichen können, hängt von mehreren Faktoren ab: Welche Aspekte rund um Freiheit und Sicherheit im Digitalen, freien Zugang zu Wissen sowie digitale Bildung oder Infrastruktur werden in der kommenden Legislatur wahrscheinlich geregelt – oder sollten aus Sicht der am Wahl-O-Mat beteiligten Organisationen geregelt werden? Und welche Regelungskompetenzen und -bedarfe bestehen auf der Ebene von Ländern, Bund und EU. Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 haben wir die Parteipositionen zu acht Themen mit Digitalbezug erhoben. Dazu gehörten unter anderem Bildung und offene Lernmaterialien, Sicherheit und digitale Überwachung, freier Internetzugang oder die offene, digitale Nutzung von Daten aus Kommunal- und Landesverwaltungen. Auch 2018 zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern und zur Bundestagswahl 2021 gab es Digital-O-Maten.
Auch vor 2017 hat Wikimedia Deutschland Parteien vor Wahlen zu ihren netzpolitischen Positionen und Vorhaben befragt. 2011 etwa haben wir alle Parteien, die zur Berliner Abgeordnetenhauswahl angetreten sind, mit 30 Fragen rund um offene Verwaltungsdaten, freie Lizenzen, Internetzugang und Open Source Software konfrontiert. Die Antworten konnten Wählende im Wiki nachlesen und so mit den eigenen Positionen abgleichen.
Vor der anstehenden Europawahl in diesem Jahr sind hingegen ganz andere Themen relevant. Mit dem aktuellen Wahl-O-Mat kann man überprüfen, wie es mit den Positionen der Parteien zu Themen wie KI-basierter biometrischer Erfassung von Menschen im öffentlichen Raum, Chatkontrolle, elektronische Identitäten und die Frage, ob Europol künftig Daten mit Unternehmen und nicht-europäischen Drittstaaten austauschen dürfen soll.

„Auf EU-Ebene werden die wichtigsten gesetzlichen Weichenstellungen vorgenommen, die dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Gesetzgebung zu digitalen Themen aus Brüssel betrifft ehrenamtliche Projekte wie die Wikipedia ebenso wie den digitalen Alltag von uns allen. Denn auf EU-Ebene werden Gesetze zur Plattformregulierung, zum Umgang mit Gesundheitsdaten oder zur Nutzung sogenannter Künstlicher Intelligenz gemacht.“ Lilli Iliev, Leiterin des Teams Politik und öffentlicher Sektor bei Wikimedia Deutschland.
Vorgänger des Wahl-O-Mat: Die Wahlprüfsteine

Auch vor 2017 hat Wikimedia Deutschland Parteien vor Wahlen zu ihren netzpolitischen Positionen und Vorhaben befragt. 2011 etwa haben wir alle Parteien, die zur Berliner Abgeordnetenhauswahl angetreten sind, mit 30 Fragen rund um offene Verwaltungsdaten, freie Lizenzen, Internetzugang und Open Source Software konfrontiert. Die Antworten konnten Wählende im Wiki nachlesen und so mit den eigenen Positionen abgleichen.
Sogenannte Wahlprüfsteine haben in Deutschland eine lange Tradition. Interessenverbände haben sie häufig vor Wahlen erstellt, um ihre Mitglieder darüber zu informieren, wie Parteien sich zu Fragen positionieren, die für sie besonders relevant sind. Der Deutsche Geerkschaftsbund (DGB) hat die Wahlprüfsteine bereits in den 50er Jahren eingeführt. Vom Bundesverband für Motorradfahrer über den Deutschen Familien-Verband, den Bund der Steuerzahler bis hin zum Lesben- und Schwulenverband gibt es zahlreiche Interessengruppe, die dieses Instrument genutzt haben, um Wahlempfehlungen für die Mitglieder oder Anhängerschaft zu erstellen.
So kommen die Positionen der Parteien in den Digital-O-Mat
Nach der Auswahl der Themen ging es an die Recherche zu den Positionen der Parteien. Dafür haben die Organisationen, die den Digital-O-Mat gemeinsam entwickelt haben, zunächst bei den Parteien nachgefragt. Und zwar bei denen, deren Einzug in das jeweilige Parlament sicher oder sehr wahrscheinlich war. Wer zunächst nicht geantwortet hat, wurde freundlich erinnert! Die Aussagen zu verschiedenen Themen sollten die Parteien belegen: mit Parteibeschlüssen, vergangenem Abstimmungsbehalten, Wahlprogrammen oder Ähnlichem.
Blieben Antworten ganz aus und konnten wir auch keine Belege für eindeutige Positionen finden, haben wir bei dem jeweiligen Thema eine neutrale Haltung angenommen. Menschen, die den Digital-O-Mat nutzen, können in der Auswertung dann detaillierte Informationen zu den Parteipositionen finden. Der Digital-O-Mat spuckt also nicht nur Ergebnisse aus, er legt auch offen, welche Inhalte dahinter stehen.
Wer hat’s erfunden – und warum?
Über die Jahre haben sich verschiedene Vereine aus der digitalen Zivilgesellschaft als “Koalition Freies Wissen” daran beteiligt, zu verschiedenen Wahlen Digital-O-Maten zu erstellen. Die Ursprungsversion haben neben Wikimedia Deutschland sechs weitere Vereine erarbeitet:
- die Bewegung für freie Infrastrukturen und offene Funkfrequenzen Freifunk,
- die Open Knowledge Foundation Deutschland sowie
- die Free Software Foundation Europe,
- die Digitale Gesellschaft,
- die Hackervereinigng Chaos Computer Club und
- das Bündnis Freie Bildung.
Sie alle verbindet das Engagement für netzpolitische Themen. Sie eint dabei, dass sie sich für die Durchsetzung von Freiheits- und Bürgerrechten im digitalen Raum und für den freien Zugang zu Wissen, Daten und Software einsetzen – mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Mitteln. Wir alle haben uns in unterschiedlicher Form an dem Projekt Digital-O-Mat beteiligt: Mit Zeit, finanzieller Unterstützung, Programmierexpertise und Code sowie mit Input dazu, zu welchen digitalpolitischen Themen die Parteien jeweils nach Positionen gefragt werden sollten – welche Themen aktuell sind und welche uns als Internetnutzende besonders betreffen.
Bei der Auswahl der Themen für den Digital-O-Mat haben die sehr unterschiedlichen Expertisen der Vereine und Bündnisse geholfen, die an dem Projekt beteiligt waren und sind. Sie haben vor den Landtags-, Bundestags-,und Europawahlen analysiert, in welchen Politikfeldern und bei welchen anstehenden Gesetzesvorhaben ein Digitalbezug da ist.
Die Software hat der Datenjournalist Sebastian Vollnhals entwickelt. Sie steht auf GitHub unter freier Lizenz zur Verfügung. Zur Europawahl 2024 hat sich die Ortsgruppe Braunschweig des Vereins Digitalcourage den Code geschnappt, den Digital-O-Mat wiederbelebt und mit Inhalten gefüttert. Der Digital-O-Mat ist damit eins von vielen Digitalprojekten in Deutschland, in dem viel ehrenamtliches Engagement steckt – und das gleichzeitig vielen Menschen nützt.
Wir engagieren uns seit 20 Jahren für die vielen digitalen Ehrenamtlichen, die in der Wikipedia Wissen frei zur Verfügung stellen. Aber auch im politischen Bereich machen wir uns dafür stark, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für alle Freiwilligen im digitalen Raum verbessern. Eine unserer Forderungen lautet zum Beispiel, dass die gemeinwohlorientierte Entwicklung von Software, Apps oder Plattformen auch als gemeinnützig anerkannt werden muss. Mehr zum digitalen Ehrenamt und unserem Engagement dafür lesen Sie hier.