Koalitionsvertrag
Fahrplan Digitalpolitik – Was wollen Union und SPD für Freies Wissen tun?

Dr. Anne-Sophie Waag

Stefan Kaufmann
Friederike von Franqué
Lilli Iliev
16. April 2025
Grundsätzlich begrüßenswert aus der Perspektive von freiem Wissenszugang: Open Source und offene Standards haben einen hohen Stellenwert bekommen. Wenn beides in eine fachlich fundierte Strategie eingebettet wird, kann neben einer besseren Digitalisierung von Staat und Verwaltung auch die Arbeit an Projekten wie der Wikipedia gestärkt werden. Denn offene Standards und Open-Source-Infrastrukturen begünstigen das Tauschen und Teilen von frei wiederverwendbaren Inhalten.
Das Informationsfreiheitsgesetz bleibt!
Die Union ist mit ihrer Forderung, das IFG abzuschaffen, nicht durchgekommen. Nachdem es breiten Protest aus der Bevölkerung, von Journalist*innen, Wikimedia Deutschland und vielen weiteren Verbänden gab, soll das Gesetz nun reformiert werden – mit „Mehrwert für Bürger*innen und Verwaltung“. Das ist die Gelegenheit, ein bundesweites Transparenzgesetz umzusetzen. Die Initiative Transparenzgesetz hat einen Entwurf vorgelegt. Denn das bisherige IFG war lückenhaft und sorgte oftmals für Mehraufwände bei Behörden. Diese mussten amtliche Informationen aus schlecht digitalisierten Unterlagen heraussuchen. Ein echtes Transparenzgesetz sorgt nicht nur für besseren Zugang zu staatlichen Informationen. Es schafft auch die notwendigen Organisationspflichten für eine einfach abrufbare Informationsverwaltung der öffentlichen Hand auf dem strategischen, organisatorischen und technischen Stand der Zeit.
Ehrenamtsförderung – wie digital wird sie?
Die Unionsparteien stehen dem Ehrenamt traditionell sehr nahe. Das schlägt sich auch im Koalitionsvertrag nieder. Union und SPD wollen ehrenamtliches Engagement „stärken und schützen“. Geplant ist ein „Zukunftspakt Ehrenamt“. Das ist begrüßenswert. Aber denken die Koalitionspartner dabei auch an Menschen, die ehrenamtlich Software entwickeln, Datenprojekte umsetzen oder Wissen in der Wikipedia teilen? An die Anerkennung des digitalen Ehrenamts in der Engagementstrategie der Bundesregierung sollte nun gezielte Förderung anschließen. Auch eine Modernisierung des Zweckkatalogs im Gemeinnützigkeitsrecht ist vorgesehen. Wir meinen: Es wird Zeit, dass die Erstellung gemeinwohlorientierter Plattformen, Apps oder Software explizit als gemeinnützig genannt werden. Bei Gesetzen zur Regulierung von Plattformen sind zudem sachgerechte Sonderregeln für gemeinwohlorientierte Internet-Strukturen nötig, etwa niedrigere Haftungsrisiken.
DigitalPakt 2.0 soll endlich auch digitale Kompetenzen fördern
Die Grundvoraussetzungen dafür, dass digitale Bildung funktioniert, sind neben der Infrastruktur auch die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften. Hier ist der neue DigitalPakt ein wichtiges Signal. Denn die Mittel können künftig in die Lehrkräftebildung und Unterrichtsentwicklung fließen. Bedarfe aus der Lehrerschaft und Bildungsverbänden wurden offenbar gehört und adressiert. Für existierende Projektvorhaben aus dem DigitalPakt Schule ist die Verlängerung des Abrechnungszeitraums um zwei weitere Jahre eine große Entlastung. Eine langfristige Finanzierung digitaler öffentlicher Bildungsinfrastrukturen sollte allerdings weiterhin vorangebracht werden.
Gesellschaftliche Teilhabe durch die Förderung digitaler Kompetenzen.
Wir begrüßen eine altersübergreifende Offensive zur Stärkung der digitalen Kompetenzen. Denn das Erlernen eines sicheren und kritischen Umgangs mit digitalen Tools und Medien ist für alle Altersklassen wichtig. Umsetzen will die Bundesregierung dieses Ziel mit „Start-ups, Wirtschaft, öffentlichen Bildungsträgern und Sozialverbänden“. Im Sinne eines gerechten Zugangs zu Bildungsangeboten sollten die entstehenden Materialien und Angebote für alle frei zugänglich und nutzbar sein. Das funktioniert, indem alle Inhalte und Tools unter freien Lizenzen (CC für Dokumente, EUPL für Software) veröffentlicht werden. Gleichzeitig sollten die Bildungspolitiker*innen der Koalition dafür sorgen, dass Menschen den digitalen Raum aktiv mitgestalten können. Im Rahmen der digitalen Offensive sollten daher auch vermittelt werden, wie man freie, offene Infrastrukturen wie das Fediverse und Mastodon und freie, kollaborative Plattformen wie die Wikipedia nutzt.
Wissenschaftskommunikation – denkt an freies Wissen!
Laut Koalitionsvertrag wollen SPD und Union eine „unabhängige Stiftung für Wissenschaftskommunikation und -journalismus“ gründen. Das ist ein wichtiger Schritt. Da öffentliche Forschung und Wissenschaftskommunikation mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, sollten sie allen Interessierten frei zur Verfügung stehen. Das funktioniert ,indem die Prinzipien von Open Science und Open Access in der Forschung gefördert werden. Denn nur wenn Publikationen frei lizenziert sind, können Forschungsergebnisse und Wissenschaftskommunikation auch in die Wikipedia einfließen. Die freie Enzyklopädie kann so auch ein barrierefreier Multiplikator für Wissenschaftskommunikation sein.
Offene Bildung ist kein Thema
Offene Bildungsmaterialien (OER) können im digitalen Raum von allen genutzt, verändert und weiterverbreitet werden. Das erleichtert Zugang zu Wissen. Auch wenn es seit 2022 eine OER-Strategie des Bundes gibt, aus der bislang bereits einige Förderlinien hervorgegangen sind, vermissen wir ein Bekenntnis, die Strategie mitsamt zukünftig relevanter Förderlinien weiterzuentwickeln. Insbesondere im Kontext generativer KI-Systeme im Bildungsbereich haben sich neue Fragen zur Erstellung, Verbreitung, aber auch Auffindbarkeit von OER (beispielsweise über automatisierte Metadatengenerierung) ergeben, die dringend weiter bearbeitet werden sollten. KI in der Bildung ohne Offenheitsanspruch und Gemeinwohlorientierung schafft Abhängigkeiten von proprietären Anbietern.
Absichtserklärung zu Open Source noch ohne klares Zielbild
Die Ankündigung „Ziele für Open Source“ realisieren zu wollen, ist gut, bleibt aber zu unklar. Eine Digitalstrategie, die beispielsweise MS-Office durch LibreOffice ersetzen möchte, würde zu kurz greifen. Denn es geht nicht nur darum, Lizenzzahlungen zu reduzieren oder örtlichen Unternehmen gegenüber internationalen Großkonzernen zu bevorzugen. Damit Vorhaben wir das Onlinezugangsgesetz in die Praxis umgesetzt werden können und Bürger*innen den Staat als leistungsfähig und verlässlich wahrnehmen können, braucht es staatliche Steuerung. Freie Software kann eine wichtige Grundlage dafür sein, dass Informationen künftig als wiederverwendbare Daten anstatt als Office-Dokumente abgelegt werden. Durch die Verwendung von Lizenzen wie der EUPL kann sichergestellt werden, dass die damit geschaffenen Ergebnisse auch langfristig als Gemeingut erhalten bleiben. Aus den Kapiteln zu Wirtschaft, Forschung und Staatsmodernisierung wird allerdings deutlich, dass vor allem eine „Vorreiterrolle in KI“ herbeigewünscht wird, die vor allem auf die Anwendung generativer KI-Systeme hinauszulaufen scheint. Da sollte die Bundesregierung ihren Blick deutlich Richtung freiem Zugang zu Informationen und offener Infrastrukturen weiten und das bislang viel zu wenig beachtete Feld regel- und logikbasierter KI-Systeme als Chance für einen eigenen, strategisch vielversprechenderen Weg begreifen.
Gemeinwohlorientierte Infrastrukturen Fehlanzeige!
Gerade jetzt, wo sich die massive Abhängigkeit Deutschlands von Tech-Konzernen besonders deutlich zeigt, gilt es, offene, unabhängige und der Gesellschaft dienende Internetinfrastrukturen zu stärken. Laut Koalitionsvertrag sei es ein wichtiges Ziel „digitale Infrastrukturen zu schützen und auszubauen“ – damit sind Mobilfunk- und Glasfasernetze gemeint. Das Potenzial, den Ausbau dieser Infrastrukturen staatlich zu steuern und damit einerseits Mehrfachausbau und andererseits weiße Flecken auf der Landkarte zu vermeiden, scheint dabei unberücksichtigt zu bleiben. Auch die Internetdienste, die auf diesen Basisinfrastrukturen aufbauen, finden sich im Koalitionsvertrag nicht wieder. Sie sollen offenbar weiter allein dem Markt überlassen bleiben. Dabei läge im Aufbau dezentraler Kommunikationsräume wie dem Fediverse und Mastodon eine gewichtige Chance, Gegenmodelle zu den bisherigen zentralisierten Plattformen zu schaffen, die wie im Falle von X nach einer Übernahme nach den Vorstellungen einzelner CEOs umgestaltet und missbraucht werden können.
„Künstliche Intelligenz“ als Zauberformel für Verwaltungsmodernisierung?
Egal ob in der Finanzverwaltung, Verwaltungsmodernisierung oder der Justiz, überall soll „KI“ für Produktivitäts- und Modernisierungsschübe sorgen. Die „KI-Offensive“ mit dem „100.000-GPU-Programm“ legt den Schluss nahe, dass mit „Künstlicher Intelligenz“ ausschließlich generative Systeme wie Chatbots gemeint sind. Das Problem: Sie produzieren Fehler, weil sie lediglich wahrscheinliche und plausibel erscheinende Aussagen treffen. Für eine Wissensnation wie Deutschland wäre es fatal, sich lediglich auf dieses Feld zu konzentrieren und dem energie- und ressourcenintensiven Wettbewerb der bestehenden großen Player hinterherzulaufen. Stattdessen sollten wir uns auf logikbasierte KI-Systeme auf der Basis sogenannter Wissensgraphen konzentrieren. Denn sie können Ergebnisse liefern, die verlässlichen, beweisbaren und logischen Regeln folgen – bei vergleichsweise minimalem Energie- und Ressourcenaufwand. Wikidata ist ein bewährtes, praktisches Beispiel, wie so ein System in der Praxis aussehen und zum Wohle aller dienen kann. Die offene und freie multilinguale Wissensdatenbank, die von einer globalen Community ständig erweitert und gepflegt wird, wächst ständig. Sie ist mit aktuell über 116 Millionen strukturierten Dateneinträgen die größte ihrer Art. Mit einem Fokus auf Wissensgraphen wie Wikidata und logikbasiert auswertbare Informationen des Staates würde die Koalition überfällige Grundlagen für eine gelingende Verwaltungsdigitalisierung schaffen.
Kein Kompass für die internationale Digitalpolitik
Um wettbewerbsfähig zu sein mit den großen, finanzstarken internationalen Playern, braucht Digitalpolitik eine offene, kollaborative Herangehensweise. Ein Vorschlag dafür ist die EuroStack-Initiative. Sie will erreichen, dass Europa von den Ressourcen über Netze bis zu Cloud-Infrastrukturen, Software und Daten eigenständig wird. Sie bleibt in der Ausgestaltung bislang jedoch diffus und fokussiert sich stark auf das Ziel der „Digitalen Souveränität“. In der Praxis wird das häufig mit staatlicher Souveränität gleichgesetzt – mit den nicht immer wünschenswerten Begleiterscheinungen wie dem Denken innerhalb territorialer Grenzen und einer Abschottung nach außen hin.
Begrüßenswert sind dennoch die in groben Strichen festgehaltenen Bekenntnisse zu Grundrechten und grundrechtskonformer Plattformregulierung, der Fortführung internationaler Digitaldialoge und der Mitarbeit in internationalen Gremien. Deutlicher hätte das Bekenntnis dazu ausfallen können, verschiedene Gruppen in Multistakeholder-Dialoge einzubeziehen. Denn in Deutschland gibt es traditionell eine starke, ehrenamtlich aktive digitale Zivilgesellschaft. Sie hat in den vergangenen Jahren viele praktische Erfahrungen damit gesammelt, woran Digitalisierungsprojekte des Staats scheitern. Trotzdem bleibt ihre Stimme bei der Erarbeitung von Digitalstrategien bis heute häufig ungehört.
Wir sind gespannt auf die Umsetzung
Die Koalitionär*innen beschreiben ihre Digitalpolitik mit vieldeutigen Begriffen. Die Rede ist von Souveränität, Innovation und gesellschaftlichem Fortschritt. Was genau damit gemeint ist, ist an vielen Stellen noch unklar. Wir meinen, Digitalpolitik ist zuerst Gesellschaftspolitik. Sie sollte im öffentlichen Interesse aktiv gestaltet werden und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen. Und dazu gehören politische Maßnahmen, die freien Zugang zu Daten, Forschung, Software, Bildung und digitalen Kulturgütern ermöglichen. Spannend wird es daher zu beobachten, wie konsequent die Koalition ihr Bekenntnis zu offenen Standards und Open Source in der Realität umsetzt – und ob die geplanten Infrastrukturinvestitionen auch in öffentliche und demokratisch kontrollierte digitale Infrastrukturen fließen werden.




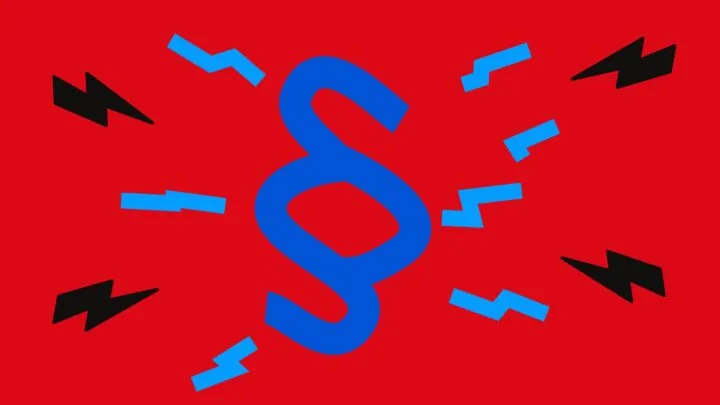
Das ursprüngliche Vorhaben eines Verbotes von freiem Wissen schockiert mich sehr. Ich bin froh, dass dieses Vorhaben erfolgreich verhindert und wieder fallen gelassen wurde.