Was macht die Krise mit der Datenpolitik? Im Wikimedia-Salon wurde über Tracking-Apps, Datenschutz und Gemeinwohl diskutiert


Lilli Iliev
16. April 2020
Die Coronakrise wirkt an manchen Stellen wie ein Kontrastmittel, das gesellschaftliche Zustände deutlicher sichtbar macht. Sie zeigt etwa das enorme Potenzial digitalen bürgerschaftlichen Engagements (von Hackspaces, die Schutzschilde produzieren bis zur Mobilisierung von 40.000 Freiwilligen für den WirvsVirus-Hackathon der Bundesregierung). Aber sie macht gleichzeitig schmerzhaft sichtbar, was digitalpolitisch in den letzten Jahren versäumt wurde, im Bereich digitaler Verwaltung, verschlafener Open-Data-Potenziale, der Verankerung digitaler Kompetenzen im Bildungssektor, des politischen Einbeziehens digitalen Ehrenamtes.
Der Wikimedia-Salon im Video:
Die geplante Datenstrategie der Bundesregierung ließ bereits in der offenen Online-Umfrage erkennen, dass der Kurs auf Gemeinwohl stehen soll. Doch welche Regeln, welche Akteure und Prozesse braucht es, damit dies gelingen kann? Im 21. Wikimedia-Salon disktuierten dazu:
- Ingrid Brodnig, Autorin und Journalistin
- Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für Datenschutz & Informationsfreiheit
- Christiane Wendehorst, Datenethikkommission der Bundesregierung, Professorin für Zivilrecht, Universität Wien
- Jürgen Geuter aka tante, Informatiker & Autor
- Moderation: Vera Linß, freie Medienjournalistin
Das Thema der Datenpolitik in diesen Wochen: Die Corona-App
Ulrich Kelber sieht in der gegenwärtigen Debatte keine neue Diskussion, sondern ein wiederkehrendes Muster: Immer werde der Datenschutz als Problem ausgemacht wenn man sonst nicht wisse, wie es vorangeht. Geschäftsmodelle statt Datenschutz, Sicherheit statt Datenschutz, jetzt Gesundheit statt Datenschutz. Ihm sei indes noch kein Projekt, kein sinnvolles technologisches Hilfsmittel untergekommen, das nur mit einer Aufweichung des Datenschutzes umgesetzt werden könnte.
Wir tendieren dazu, jetzt alles durch die Corona-Brille zu sehen, sagte Christiane Wendehorst. Sie setzt große Hoffnungen in einen gemeinsamen europäischen Prinzipienkatalog, bei der statt nationaler Alleingänge sinnvoll verzahnte Lösungen zur Bewältigung der Krise angelegt werden können. Den einen Tech Fix könne es nicht geben ohne eine analoge Infrastruktur und eine grundsätzlich ganzheitliche Betrachtung der Situation – trotz des großen Zeitdrucks.
Jürgen Geuter besorgt das „Panik-Potenzial“ von Hilfsmitteln wie der jüngst vorgestellten RKI-App. Informationen über mögliche Kontakte mit Infizierten können mehr Schaden anrichten als nützen, gerade bei Menschen, die unter immensem psychischem und sozialem Stress stehen. Geuter vermisst eine stärkere Berücksichtigung des sozioökonomischen Kontextes, einer besonnenen Art der Kommunikation und Beratung, bevor solche Apps eingesetzt werden.
Ganz anders sieht das Ingrid Brodnig aus ihrer Erfahrung mit der in Österreich bereits eingesetzten Stop-Corona-App des Roten Kreuzes. Die App sei als schnellerer Kommunikator zu verstehen; Brodnig wolle lieber möglichst viele Informationen über mögliche Kontaktpunkte haben. Voraussetzung sei die Freiwilligkeit der App und transparente politische Kommunikation. Brodnig betonte, dass technologische Lösungen wie Apps nicht im Widerspruch zum Datenschutz stehen. Wie Corona-Apps im Einklang mit Datenschutz-Standards gelingen können, dazu hat die vom Datenschutz-Aktivisten Max Schrems ins Leben gerufene Organisation noyb bereits Leitlinien veröffentlicht.
Gemeinwohlorientierte Datenpolitik? Der Staat muss endlich Vorbild sein.
„Wenn man eine Datenpolitik will, die gemeinwohlorientiert ist, muss der Staat seine Vorbildfunktion wahrnehmen.“ sagte Jürgen Geuter und nannte die selbstverständliche Bereitstellung etwa von Verwaltungsdaten in offener und verarbeitbarer Form als seit Jahren größte Baustelle. Aber selbst dann reiche es nicht aus, „nur Daten in die Öffentlichkeit zu kippen“. Es müsse sichergestellt werden, dass Daten wirklich von der Allgemeinheit genutzt werden und ihr nützen (und nicht vordergründig profitorientierten Interessen). Die Schwäche der Empfehlungen der Datenethikkommission sieht Geuter darin, dass sie eben keine Ethik formuliert habe, die den Empfehlungen zugrunde liegt. Er habe sich eine Debatte über ethische Leitlinien und damit den Anstoß für ein gesellschaftliches Nachdenken über Moral, angewendet auf den digitalen Raum, gewünscht.

Ingrid Brodnig sagte, wir können nicht über Gemeinwohlorientierung reden, ohne das Wettbewerbsrecht anzufassen und die übergroße Datenmacht einzelner Konzerne regulatorisch einzudämmen und etwa Interoperabilität einzufordern. Wettbewerbsfeindlichen Akquisen müssten künftig verboten werden können. Auch brauche es eine vorgelagerte öffentliche Diskussion, wo wir datenbasierte Entscheidungen über Menschen überhaupt haben möchten (siehe Beispiel Arbeitsmarktservice Österreich über die Vergabe von Weiterbildungen). Die öffentliche Hand müsse hier transparenter in ihren internen Entscheidungsprozessen werden. (Ausführliche Analysen und Empfehlungen dazu auch in ihrem Buch „Übermacht im Netz“)
Wünsche für die Datenstrategie der Bundesregierung
Abschließend erklärten die Gäste, welche Hoffnungen sie mit der Datenstrategie der Bundesregierung verbinden. „Warum gibt es eigentlich nicht so etwas wie einen Ehrenamtsserver?“, fragte Ulrich Kelber. Mit geprüfter Open-Source-Software und rechtlich sauber könne die öffentliche Hand hier vorangehen, um das Zusammenleben über digitale Wege gemeinsam neu zu organisieren. Man sehe jetzt in der Krise, dass ehrenamtlich Engagierte oft einfach nicht wissen, welche tools sie am besten nutzen sollen. Außerdem sieht viele kreative Ideen für die Nutzung öffentlicher Daten aus der Gesellschaft. „Es müssen nicht immer staatliche Institutionen sein.“ Kelber betonte außerdem, dass Datenschutz bereits die Gemeinwohlorientierung in sich trägt.
Christiane Wendehorst wünscht sich, dass die vielen guten Ansätze für eine deutsche und auch europäische Datenstrategie auch nachhaltig umgesetzt werden. Die große Gefahr sei, dass wir eine Datenstrategie 2020 präsentiert bekommen, die aber kurzfristige Projekte fokussiert statt den großen Bogen zu spannen. Sie freute sich, dass das Konzept der digitalen Souveränität inzwischen ins politische Bewusstsein eingedrungen sei. Gerade jetzt werde deutlich, in welcher Weise wir etwa im Gesundheitsbereich tenstrategie von Versorgungsketten abhängen. Im digitalen Bereich sei das noch viel komplexer. Mehr Eigenständigkeit und Souveränität sei daher als Leitprinzip für eine Datenstrategie essenziell. Wendehorst erläuterte außerdem die Empfehlungen der Datenethikkommission, die Im Oktober 2019 vorgestellt wurden; im besonderen die Vorteile eines risikobasierten Ansatzes beim Einsatz von Algorithmen. Danach sollen diese nach ihrer gesellschaftlichen „Kritikalität“ bewertet werden: Je kritischer sie sind, desto stärker müssen sie kontrolliert werden. Alle Algorithmen zu prüfen sei aufgrund ihres massenhaften Einsatzes unmöglich.
Einen einfacherern Zugang zu Daten etwa für Journalistinnen und Journalisten wünscht sich Jürgen Geuter. Mehr institutionelle Förderung sei nötig sowie die Schaffung von Infrastrukturen, an die Projekte andocken können. Leute, die etwa mit offenen Daten etwas tun wollen, sollten von Verwaltungsmühen entlastet werden.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen, dem Team von ALEX Offener Kanal Berlin und allen Interessierten!



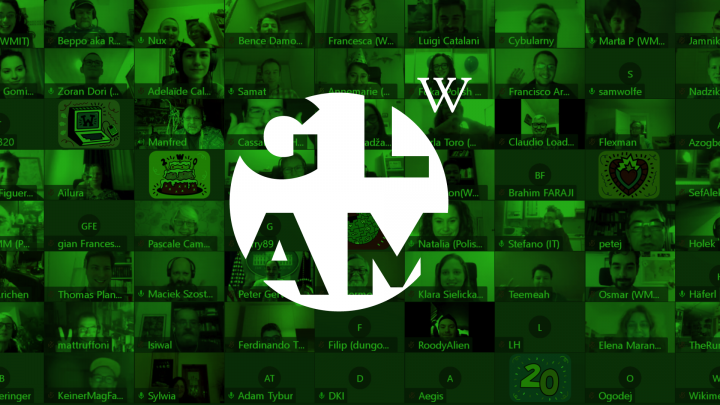
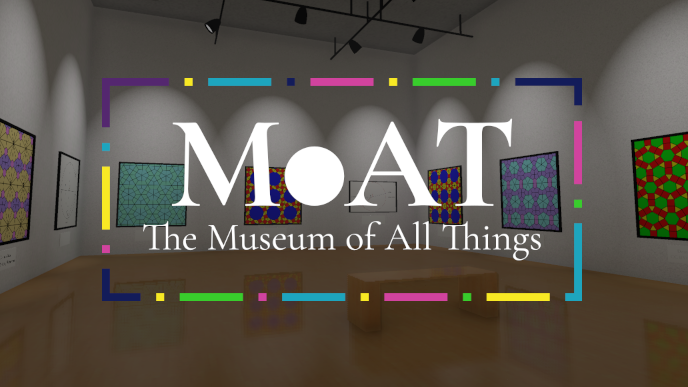

#wmdeSalon mit M$ Windows. :(