Petition
Social Media öffne dich! Petition für Forschung zu schädlichen Wirkungen von Social Media


Franziska Kelch
18. Juli 2025
Was wir über Instagram, TikTok und Co. wissen
Nach der großen Social-Media-Euphorie der letzten 15 Jahren ging in Deutschland 2024 die Nutzung von Social Media und auch die Aktivität auf den kommerziellen Plattformen erstmals wieder zurück. Das kann auch damit zu tun haben, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien veröffentlicht wurden, die problematische Funktionsweisen und negative Effekte von sozialen Medien bekannt gemacht haben.
Eine Studie von 2018 hat gezeigt: Falsche Nachrichten verbreiten sich auf Twitter schneller als Fakten. Eine Untersuchung von 2020, die Facebook in den Blick genommen hat, stellt ähnliches fest: Die Plattform leitete ihre Nutzenden vor der Wahl im Jahr 2016 häufiger auf nicht vertrauenswürdige, statt auf seriöse Nachrichtenseiten. Das sagt noch nichts darüber aus, ob und wie diese Entwicklung Wahlentscheidungen beeinflusst. Politische Einstellungen und Wahlentscheidungen sind bei den meisten Menschen über lange Zeit stabil.
Aber diese und andere Studien zeigen ein Muster auf: Social Media Plattformen bevorzugen Inhalte, die mindestens polarisierend oder irreführend und oft einfach falsch sind. Neben dem Suchtfaktor, den Social Media haben kann und negativen Auswirkungen auf Körper- und Geschlechterbilder ein Grund mehr, diese Plattformen stärker zu beobachten und zu regulieren.
Abhilfe schaffen soll in Europa der Digital Services Act (DSA). Er ist ein Instrument, mit dem die EU die großen Plattformbetreibenden auch zu mehr Transparenz verpflichtet. Bisher wurde das Potenzial des DSA aber noch nicht vollständig genutzt. Mit einem sogenannten delegierten Rechtsakt zum DSA hat die EU-Kommission am 2. Juli die Grundlage dafür geschaffen, dass und wie qualifizierte Forschende Zugang zu Plattformdaten erhalten, um Mechanismen und Risiken erforschen zu können.
Was wir nicht wissen – aber erforschen sollten
Während gut dokumentiert ist, dass sich falsche oder polarisierende Inhalte besonders schnell verbreiten, ist weitgehen unklar: Wie geht das? Welche Funktionen und Algorithmen liegen dem zugrunde? Genau das, so die Petition, soll die EU-Kommission erforschen.
Ein Ziel: Die Nutzenden erhalten so mehr Klarheit darüber, welche negativen Effekte von Social Media Plattformen wie entstehen. Aber vor allem geht es darum, dass die europäischen Gesetzgebenden so herausfinden können, welche Gegenmaßnahmen sie gegen unfaire Algorithmen treffen können. Denn solange sich Lügen schneller verbreiten als Fakten, wird auch die Forderung immer lauter, mehr zu löschen. Statt Lügen nachträglich zu löschen, sollten politische Akteur*innen dafür sorgen, dass sie sich auf den großen Plattformen gar nicht erst so schnell verbreiten.
Das geht nur, wenn die EU-Kommission die Mechanismen untersucht, die Desinformation zum Erfolgsmodell machen. Und dann muss sie die Plattformen zwingen, bessere Alternativen anzubieten.
Wikimedia Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnenden der Petition, die von Alexandra Geese (Mitglied des Europäischen Parlaments) gestartet wurde. Mit dabei sind außerdem Shoshana Zuboff („Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ & emeritierte Harvard-Professorin), Markus Beckedahl (netzpolitischer Aktivist und Gründer von netzpolitik.org), Digitalcourage e.V. (Verein „für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter”) und Stefan Mutmacher (Influencer, Netz-Aktivist und Gründer von #ProtestWählen)



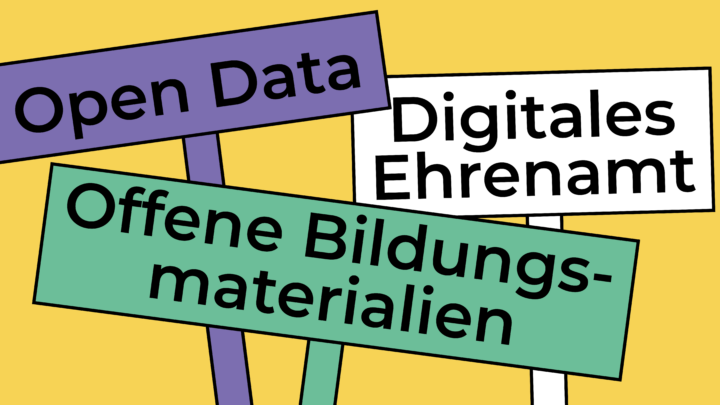

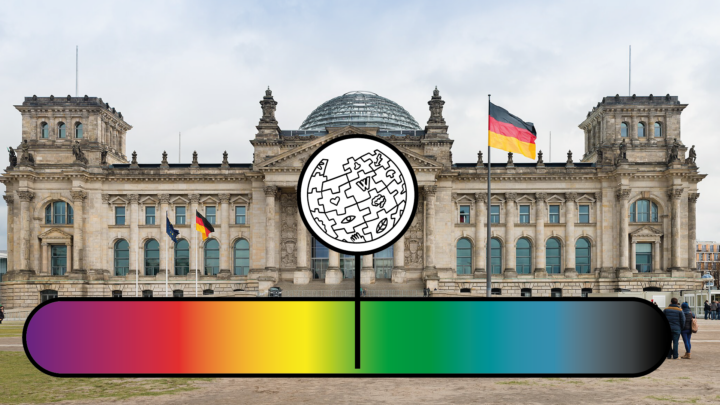
Ich unterzeichnete eine Petition für freie Fastendiäten Freiheit der Fakten, kann diese aber nur über WhatsApp teilen. Passt nicht zusammen oder? Grüße Henning