Digitales Ehrenamt
Wege, Chancen und Hürden im digitalen Ehrenamt: Erkenntnisse aus dem Vierten Engagementbericht
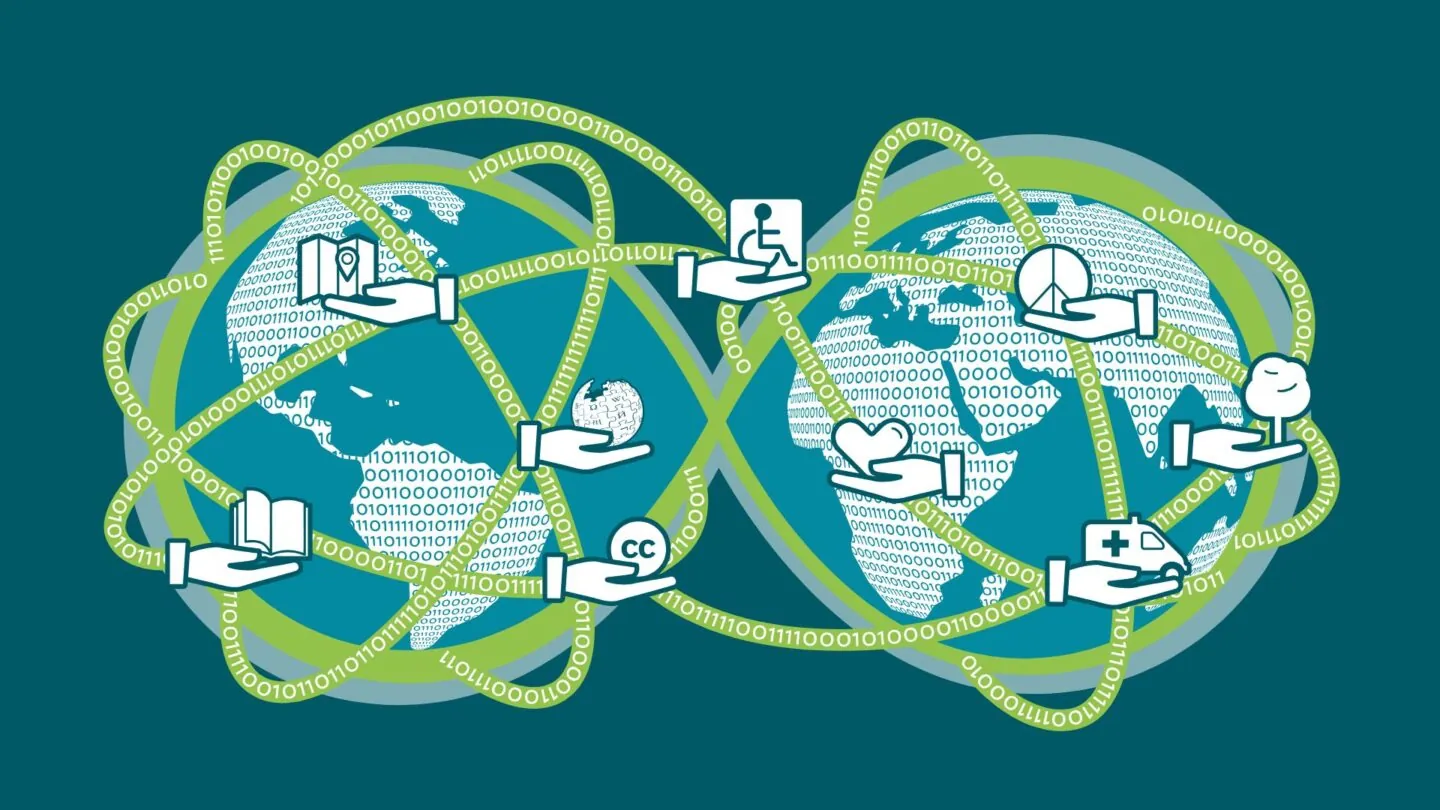

Hanna Klein
3. Juli 2025
Was ist der Engagementbericht der Bundesregierung?
Seit 2009 veröffentlicht die Bundesregierung in jeder Wahlperiode einen Bericht zum freiwilligen Engagement in Deutschland – erstellt von einer unabhängigen Sachverständigenkommission. Dieser Bericht soll eine nachhaltige Engagementpolitik unterstützen und Handlungsempfehlungen geben.
Hallo Nina, gibt es im Vierten Engagementbericht neue Erkenntnisse oder Trends, die wir so vorher nicht kannten?
Im vierten Engagementbericht der Bundesregierung geht es um Zugangschancen zum freiwilligen Engagement. Auch wenn viele der darin beschriebenen Phänomene – etwa soziale Ungleichheit als zentrales Hindernis – nicht neu sind, liegt der Wert des Berichts in der klaren Darstellung und Systematisierung dieser Themen. Er zeigt eindrücklich, dass nicht alle sozialen Gruppen im freiwilligen Engagement gleichermaßen vertreten sind. Faktoren wie Einkommen, Bildungsabschluss, berufliche Situation, Herkunft oder Gesundheit beeinflussen die Zugangschancen für ein Ehrenamt. Diskriminierungserfahrungen treten im freiwilligen Engagement glücklicherweise aber seltener auf als in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Erwerbsarbeit oder Ämtern.
Besonders bemerkenswert ist, dass Menschen mit niedrigem Schulabschluss oder geringerem Einkommen zu einem hohen Anteil zur Gruppe der „Engagementbereiten“ zählen. Es besteht also viel Potenzial, das bislang nicht ausreichend ausgeschöpft wurde.
Was braucht es dann laut Bericht, damit Engagementbereite auch aktiv werden?
Der Bericht macht deutlich, wie wichtig gleiche Zugangschancen für alle sind. Das gefällt mir besonders gut. Nicht, weil alle sich engagieren sollen, sondern weil Ehrenamt zentral für eine lebendige Demokratie ist und eine persönliche Chance sein kann! Ehrenamt macht Spaß, zum Beispiel, weil man merkt, dass das eigene Handeln einen Unterschied macht. Man entwickelt sich weiter, lernt immer wieder dazu und das alles gemeinsam mit anderen.

Ehrenamt kann eine persönliche Chance sein!Nina Leseberg Bereichsleiterin Communitys und Engagement bei Wikimedia Deutschland
Was bedeuten die Erkenntnisse aus dem Bericht für ehrenamtliches Engagement in der Wikipedia, Wikidata oder Wikimedia Commons?
Anders als klassische Formen des Engagements – das zeigt der Bericht auch – kann digitales Engagement besonders inklusiv sein. Es ist orts- und zeitunabhängig und vielfältig in der Form. Gerade junge Menschen, Menschen in ländlichen Räumen oder solche mit körperlichen Einschränkungen finden über das Digitale einen Zugang zu zivilgesellschaftlichem Engagement.
In der Wikipedia kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit spontan Artikel schreiben. Solange Internet und ein Computer vorhanden sind, kann das von überall in der Welt aus passieren. Wer nicht gerne schreibt, kann Fotos auf Wikimedia Commons oder Daten bei Wikidata hochladen. Einige engagieren sich auch für die Community, organisieren Veranstaltungen, helfen anderen bei ihren ersten Schritten in der Wikipedia oder initiieren Kooperationen etwa mit Museen oder Bibliotheken. Eine weitere Stärke kann auch die Anonymität sein. Durch die pseudonymen Benutzernamen ist es egal, wer du bist. Es kommt darauf an, was du beiträgst. Ob du Professor bist oder arbeitslos, das weiß hier keiner und meiner Einschätzung nach interessiert das auch niemanden. Insbesondere für neurodiverse oder introvertierte Menschen kann ein digitales Engagement auch niedrigschwelliger sein, da weniger direkte soziale Kontakte nötig sind.
Trotzdem wirkt nur eine begrenzte Zahl an Menschen in den Wiki-Projekten mit. Warum ist das so?
Um sich bei Wikipedia zu engagieren, braucht es bestimmte Kompetenzen – das ist an sich auch in Ordnung, denn nicht jede Form des Engagements passt zu jeder Person. Dennoch sollten wir selbstkritisch hinterfragen, warum Menschen nicht aktiv werden, obwohl sie eigentlich das Potenzial und Interesse mitbringen.
Es ist nicht jedes Engagement für jede Person geeignet. Allerdings müssen wir uns ehrlich und selbstkritisch fragen: Warum werden Menschen nicht aktiv, obwohl sie durchaus für das Engagement geeignet sind und mitmachen könnten?
Laut Engagementbericht soll die Aufnahme und Ausübung eines freiwilligen Engagements unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Bildungshintergrund, sozioökonomischem Status oder Herkunft individuell möglich sein. Ist das in der Wikipedia der Fall?
Wenn wir uns die Gruppe der Ehrenamtlichen in der Wikipedia anschauen, dann stellen wir schnell fest, dass sie sehr homogen ist. Der Bericht zeigt, dass das in fast allen Organisationen und ehrenamtlichen Initiativen so ist. Da sind wir leider keine Ausnahme. Das bestärkt uns darin, die Community weiter dabei zu unterstützen, Schwellen zu reduzieren, damit mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen mitmachen können.
Das entspricht der Empfehlung im Bericht, ein Umfeld zu schaffen, in dem benachteiligte gesellschaftliche Gruppen sich ohne Angst vor Diskriminierung engagieren können. Die Kommission empfiehlt eine kritische Selbstreflexion der Organisationskultur. Organisationen sollen ihre internen Routinen, Sprache und Strukturen überprüfen. Oft wirken unbewusste Mechanismen ausschließend, wie etwa beim Onboarding neuer Engagierter. Wichtig sind auch barrierefreie Zugänge (physisch und digital) sowie transparente Prozesse für neue Engagierte.
Welche konkreten Angebote macht Wikimedia Deutschland, um den Hürden zu begegnen?
Wikimedia Deutschland fördert ganz konkret Maßnahmen, die den Zugang zum Engagement erleichtern: Reisekosten, Kosten für Übernachtungen und Verpflegung werden zum Beispiel übernommen, sodass auch Menschen mit geringem Einkommen an Veranstaltungen teilnehmen können. Zudem sind in unserer neuen Förderrichtlinie explizit Angebote zur Teilhabe und für mehr Diversität vorgesehen: von Dolmetschdiensten – etwa in Gebärdensprache – bis zu technischen Hilfen.
Was das Onboarding neuer Ehrenamtlicher angeht: Wir unterstützen die Ehrenamtlichen dabei, das Onboarding inklusiv zu gestalten. Erst letzten Monat gab es zum Beispiel eine Train the Trainer Schulung speziell für Menschen aus marginalisierten Gruppen. Einen wichtigen Beitrag leistet auch unsere Beratungsstelle, die bei Überlastung (sogenanntem Ehrenamtsburnout), Diskriminierungserfahrung oder bei Konflikten innerhalb der Community unterstützt. Das Team Marginalisiertes Wissen wiederum erprobt Wege, um marginalisiertem Wissen mehr Raum und Sichtbarkeit zu verschaffen.
Besonders wichtig sind meiner Einschätzung nach auch Initiativen aus der Community, wie etwa das FemNetz, das sich für feministische Anliegen engagiert, oder die Jungwikipedianer, die junge Menschen für die Wikipedia begeistern. Im Engagementbericht werden Netzwerke ebenfalls als zentrale Ressource für den Zugang zu einem Ehrenamt beschrieben.
Was sollte von politischer Seite getan werden, um mehr Menschen im digitalen Ehrenamt zu unterstützen?
Der Bericht zeigt, wie wichtig es ist, digitale und informelle Formen des Engagements politisch stärker anzuerkennen und zu fördern – ein Punkt, den wir als Organisation mit unserem Fokus auf Freies Wissen und digitales Ehrenamt ausdrücklich begrüßen.
Damit sich noch mehr Menschen digital ehrenamtlich engagieren, braucht es politische Anerkennung und gezielte Förderung. Außerdem sollte der Zugang zu offenen Daten und Kulturgütern verbessert und rechtlich abgesichert werden. Projekte wie Wikipedia oder OpenStreetMap sind auf offene Inhalte angewiesen – viele digitale Ehrenamtsinitiativen scheitern an restriktivem Zugang. Grundsätzlich sollten Menschen besser befähigt werden, digitale Technologien zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und digitale Räume aktiv mitzugestalten. Dazu gehört auch, dass Politik mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, wenn es um die Ausgestaltung von Digitalpolitik geht. Schließlich werden Schutzmechanismen gegen digitale Gewalt, Desinformation oder Einschüchterungsversuche immer wichtiger – gerade für Menschen, die sich digital für Freies Wissen, Demokratie und Menschenrechte einsetzen.
Der Bericht zeigt, wie wichtig es ist, digitale und informelle Formen des Engagements politisch stärker anzuerkennen und zu fördern – ein Punkt, den wir als ausdrücklich begrüßen.
Und auf Mikroebene? Was erfahren wir darüber, was einzelne Menschen motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Der Bericht zeigt: Menschen engagieren sich häufig, weil sie angesprochen werden – und das geschieht vor allem über Netzwerke. Was interessant ist: Besonders entfernte Bekannte oder Kolleg*innen sind entscheidend, weniger enge Freunde oder Familie. Andere Studien zeigen, dass es wichtig ist, früh Erfahrungen mit Ehrenamt zu machen, etwa weil man es im Umfeld – zum Beispiel von den Eltern – mitbekommt. Wer aus strukturellen Gründen weniger Kontakte zu Menschen hat, die sich engagieren, bleibt häufiger außen vor.
Für Wikimedia ist das eine wertvolle Erkenntnis: Am besten finden Menschen über Menschen in die Wikipedia, die ihnen von ihrem Engagement berichten. Das erleben wir auch in der Wikipedia-Community oft. Niemand kann überzeugender für ein Ehrenamt werben, als die Menschen, die für ihr Engagement brennen.
Mitmachen
Alle, die neugierig geworden sind und mehr über das Mitmachen erfahren möchten, finden bei den Wikimedia-Projekten viele spannende Möglichkeiten.
Ob das Verfassen von Artikeln, das Beitragen von Bildern oder die Pflege von Daten – gemeinsames Wissen wächst durch vielfältiges Engagement. Für den Einstieg bieten die Neulings-Startseite von Wikipedia und die 30-Tage-Wikipedia-Challenge eine hilfreiche Orientierung mit praktischen Tipps.




