
Patrick Wildermann
31. Juli 2025
Ralph, Du bist Vorstandsmitglied, Schatzmeister und Webmaster von FürthWiki e. V. und setzt Dich als Benutzer:Zonebattler für Freies Wissen ein. Wie hat Deine Geschichte mit dem FürthWiki begonnen?
Ralph Stenzel: Als Bürger, der seit 26 Jahren in Fürth lebt, habe ich mich vor geraumer Zeit gegen den drohenden Abriss eines historischen Hotels und dessen weitgehend erhaltenen Festsaals in unserer Stadt engagiert. Leider hatte diese Bürgerinitiative keinen Erfolg, was mich ziemlich frustriert hat. Ich suchte nach einem neuen zivilgesellschaftlichen Engagement, welches nachhaltiger wirkt und bei dem ich nicht absehbarerweise den Kampf gegen die finanziellen Interessen von Investoren verliere. In diese Zeit fiel 2012 die Gründung eines Trägervereins für das FürthWiki, welches online bereits seit 2007 existiert. Das Projekt sprach mich an, also wurde ich Teil des Gründungsteams von FürthWiki e. V. – ein Verein, der heute bereits 136 Mitglieder hat.
Was sind Deine Schwerpunkte?
Mir selbst liegen Orga-Themen, also bin ich neben meiner Tätigkeit als Vorstand und Schatzmeister des Vereins der Kümmerer in unserem FürthWiki-Laden, den es jetzt seit fünf Jahren gibt. Mit der Artikelarbeit beschäftige ich mich selbst etwas weniger, halte aber den Ehrenamtlichen, die sie erledigen, den Rücken frei. Die freuen sich, den Laden immer in einem guten und vorzeigbaren Zustand vorzufinden.

Wie genau funktioniert ein RegioWiki? Was findet dort Eingang?
RegioWikis sind die “kleineren Geschwister” der großen Wikipedia. Während die Wikipedia per definitionem ein Weltlexikon für alles und jedes ist, beschäftigen sich RegioWikis wahlweise mit Regionen, Städten oder Kommunen. Quasi nebenan hat sich kürzlich das OberpfalzWiki gegründet, wir selbst befassen uns ausschließlich mit Themen, die Fürth betreffen. In unserem Wiki ist alles relevant, was mit der Stadt zu tun hat. Oder sagen wir: fast alles. Ich erinnere mich an den Fall einer Musikgruppe, deren einziger Fürth-Bezug darin bestand, dass sie ihr Abschiedskonzert vor ihrer Auflösung in der Fürther Stadthalle gegeben hat…
Das reicht nicht?
Nein. Es gibt auch bei uns Löschanträge, über die ein Kuratorium transparent diskutiert und befindet, damit niemand behaupten kann, es gäbe Willkür seitens anonymer Administratoren. Aber insgesamt liegt die Relevanzschwelle niedrig. Das ist gerade für Anfängerinnen und Anfänger hilfreich, die beispielsweise über eine Fürther Person schreiben wollen, die sie kennen. Wenn es eine Künstlerin ist, wird nicht gefragt: wie viele Ausstellungen hat sie schon gemacht? Bei einem Musiker muss nicht nachgewiesen werden, dass er schon soundsoviele Alben herausgebracht hat. Ein weiterer sehr motivierender Faktor ist: Im Gegensatz zur Wikipedia besteht bei uns kein Forschungsverbot. Im Gegenteil, wir ermutigen eigene “Ausgrabungen”.
Was genau meinst Du damit?
In die Wikipedia findet ja nur Eingang, was mit einer bereits existierenden Publikation belegbar ist. Bei uns fördern Autorinnen und Autoren anhand von Akten oder Dokumenten aus dem Stadtarchiv auch Geschichten zutage, die noch nirgends publiziert sind. Ein Beispiel: Es gab in Fürth einen prominenten Stadtheimatpfleger und Chef des Stadtarchivs, der im Zweiten Weltkrieg im polnischen Toruń als nationalsozialistischer Propaganda-Offizier tätig war – Adolf Schwammberger. Die unrühmlichen Kapitel aus seiner Biografie waren aber vollständig unbekannt, daheim wollte wohl auch niemand etwas davon wissen. Einer unserer Forschenden, Kamran Salimi, hat im Stadtarchiv von Toruń etliche Akten und Fotos zutage gefördert, die Schwammbergers Wirken in der NS-Zeit grell beleuchtet haben – so dass schließlich sogar die nach ihm benannte Straße in Fürth umbenannt wurde.
Was unterscheidet RegioWikis sonst noch von der Wikipedia?
Stadt- und RegioWikis haben einen ganz anderen Fokus und Zugang. Nehmen wir als Beispiel die beiden Fürther Ludwig Erhard und Henry Kissinger. Im Wikipedia-Artikel über Ludwig Erhard finden sich natürlich vor allem Informationen über seine Bundeskanzler-Zeit. Im FürthWiki-Artikel geht es viel ausführlicher um sein Geburtshaus und das Verhältnis zu seiner Heimatstadt. Auch bei Henry Kissinger liegt der Akzent weniger auf der Weltpolitik, als vielmehr auf seiner Kindheit und Jugend in Fürth als Sohn einer jüdischen Familie. Insofern ergänzen sich RegioWikis und Wikipedia vortrefflich. Wir fungieren sogar als Türöffner zur Wikipedia…
Inwiefern?
Bei uns lernen die Leute das Editieren, das grundsätzliche Arbeiten, das Belegen – alles unter Anleitung und Mentorenschaft. Entsprechend haben sie später weniger Berührungsängste, sich an der Wikipedia zu versuchen. Insofern sind wir eine Art “Rekrutierungsbüro” für die Wikipedia mit sehr niedriger Eingangsschwelle.
Sind RegioWikis eine Konkurrenz zu Lokalzeitungen?
Das wird teilweise wohl tatsächlich so empfunden. Die Entwicklung der Lokalpresse ist ja bekannt: alles, was früher Geld gebracht hat, ist ins Internet abgewandert. Entsprechend bauen die Redaktionen Kapazitäten zurück und schicken keine Reporter mehr raus. Oft genug finden wir Teile unserer FürthWiki-Texte in der Zeitung wieder, ohne dass es explizit benannt worden wäre. Wobei man differenzieren muss: Es gibt tagesaktuelle Events wie den jährlichen Erntedankumzug oder ein Kunstfest, die Ehrenamtliche für das FürthWiki fotografieren. Aber wir verstehen uns natürlich nicht als Presse-Ersatz und schon gar nicht als Konkurrenz: Wir schreiben keine Meinungsartikel, wir dokumentieren. Dennoch finden sich bei uns teilweise Informationen, für die man bei der Presse zahlen müsste…
Wird euer Engagement von der Stadt Fürth wertgeschätzt?
Grundsätzlich schon, wir sind innerhalb der Stadt bestens vernetzt, das reicht vom Museumsleiter über die Intendantin des Stadttheaters bis weit in die Kommunalpolitik. Zugleich sind meine Vorstandskollegen und ich heilfroh darüber, dass unser FürthWiki-Laden nicht von einem lokalen Unternehmer oder gar der Stadt gesponsert wird. Dadurch, dass Wikimedia Deutschland den Raum unterstützt, haben wir keinerlei Interessenkonflikte, keine Schere im Kopf – könnte der Artikel XY eventuell dem Oberbürgermeister nicht gefallen?
Was findet im FürthWiki-Laden statt? Wem steht der Raum offen?
Das Besondere ist: Wir sind einer von sechs Lokalen Räumen in Deutschland, die Wikimedia fördert – aber der einzige, der keine Gruppe von Wikipedia-Aktiven beherbergt, sondern ein StadtWiki. Diese thematische Fokussierung schafft eine starke gemeinsame Klammer. Wir haben eine Vielfalt von Veranstaltungsformaten, darunter ein Arbeitstreffen an jedem ersten Mittwoch im Monat – mit einer Agenda, die von allen Aktiven befüllt wird, unterteilt in inhaltliche Themen Fürth betreffend, technische Themen, Orga-Themen. Daneben gibt es den sogenannten Mitmach-Mittwoch, den “Wiki-Wednesday” für die zwischenmenschliche Komponente. Da versuchen wir, die Isoliertheit der Autorinnen und Autoren am Schreibtisch zu überwinden, so sie es denn selbst wollen.

Wie groß ist eure Community, wie ist sie aufgestellt?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Wenn ich die Spezialseite mit den Bearbeitungen der vergangenen 30 Tage als Maßstab heranziehe, würde ich sagen: wir haben etwa drei Dutzend regelmäßig Beitragende. Darüber hinaus gibt es eine große Menge Menschen, die sich nur temporär und/oder fallweise mit Edits bemerkbar machen. Wir sind natürlich darum bemüht, dass die Community möglichst divers ist – wie das FürthWiki selbst. Es gibt zum Beispiel die Gruppe der Unabhängigen Frauen Fürth, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen im FürthWiki sichtbarer zu machen – angelehnt an das gleichnamige Wikipedia-Projekt der Women in Red. Sie haben bei uns regelmäßig Veranstaltungen, die im Kalender bewusst als gockelfreie girls only-Events geführt werden. Es gibt auch einen automatischen Abfrage-Zähler: wie viele weibliche Biografien hat das FürthWiki, wie viele männliche? Den Gender Gap wollen wir nach Möglichkeit langfristig schließen.
Wie sind die Stadt- und RegioWikis miteinander vernetzt?
Es gibt alle zwei Jahre das Format der StadtWiki-Tage, das 2025 in Tübingen stattfand, 2018 waren wir selbst Ausrichter. Die StadtWiki-Tage ähneln der WikiCon, natürlich eine Dimension kleiner. Aber es werden dort etwa interessante technische Innovationen vorgestellt und vergemeinschaftet, die es in der Wikipedia noch nicht gibt. Ein Beispiel sind Slider-Fotos, wir nennen sie “Zeitverschiebungen”: eine historische Aufnahme wird mit einem aus gleicher Perspektive fotografierten Bild aus der Gegenwart übereinandergelegt, mit der Maus kann man zwischen früher und heute hin und her ziehen. An die 100 unserer Wiki-Artikel sind schon mit solchen eindrucksvollen Visualisierungen versehen. Ansonsten findet die Vernetzung der RegioWikis weniger im inhaltlichen Bereich statt, wir tauschen uns eher zu grundsätzlichen Fragen aus – beispielsweise, welche Formate Erfolg gebracht haben und welche weniger. Man kann immer voneinander lernen!
Wie versucht ihr, neue Aktive zu gewinnen?
Wir brennen ein Feuerwerk an Möglichkeiten ab. Zum Beispiel veranstalten wir jeden Dienstag eine Sprechstunde zum Erstkontakt für Leute, die vielleicht mitmachen oder uns Dokumente aus Nachlässen spenden wollen. Wir führen unser Vereins-Blog, jeder neue Beitrag darin triggert eine automatische Benachrichtigung an knapp 800 Leute aus unserem Verteiler. Wir arbeiten mit Schulen zusammen, dem Stadtarchiv, der Volkshochschule, dem Stadttheater. Letztlich wissen wir nicht im Voraus, was funktioniert. Wir wissen nur, dass man jede Gelegenheit nutzen muss, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Dafür ist es wichtig, eine motivierende Willkommenskultur zu schaffen und zu etablieren.
Wie schafft man die?
Jede und jeder, die oder der bei uns die Nase zur Tür hereinstreckt, wird sofort in Empfang genommen, herzlich begrüßt und unaufdringlich, aber nachhaltig bekümmert. Wir wollen zeigen: Hier habt ihr eine Plattform, auf der ihr euer Ding machen könnt. Ihr müsst halt lexikalisch schreiben, nicht lyrisch. In Fürth ist das Interesse an Geschichte grundsätzlich sehr ausgeprägt, gerade auch bei den jüngeren Generationen. Die wollen wir erreichen.



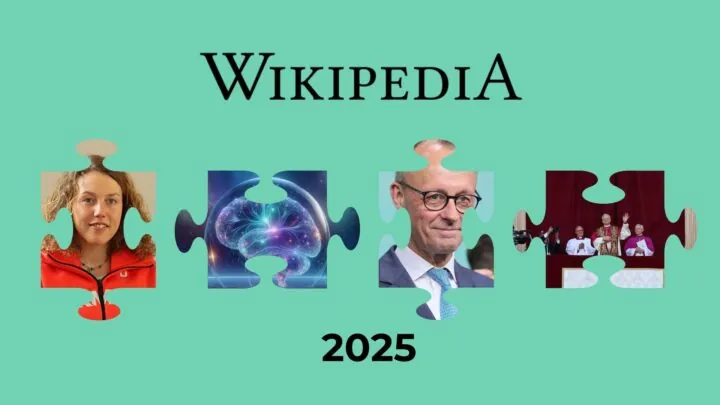
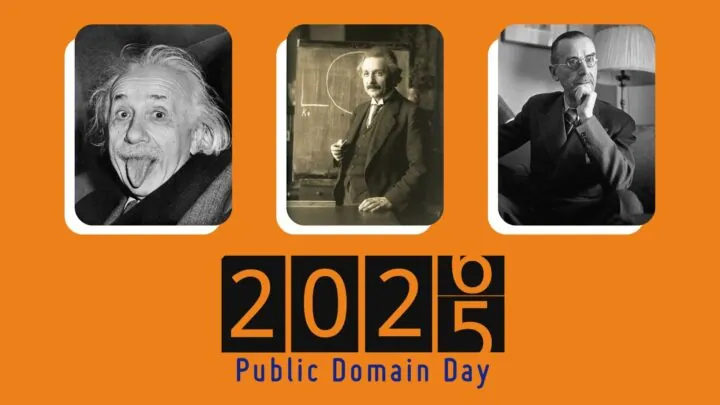

Wow! In Fürth gibt es mehr als zwei halbwegs anständige Menschen?!? Ich werde herausbekommen, wo dieser Laden ist und schauen, ob ich mich irgendwie noch nützlicher machen kann als nur durch Geld.
Guten Tag Herr Menzel, wie schön, dass Sie sich für eine Mitarbeit im FürthWiki-Laden interessieren. Dieser befindet sich in der Gustavstraße 5. Immer dienstags von 16-18 Uhr findet eine öffentliche Sprechstunde statt. Schauen Sie gerne vorbei. Mit besten Grüßen, Hanna Klein (Wikimedia Deutschland)