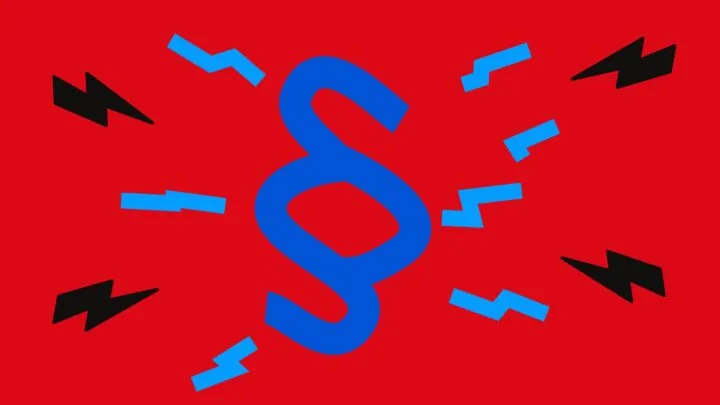Interview
Für grenzenloses Wissen: Darum braucht Wikipedia internationales politisches Engagement

Franziska Kelch
28. Juli 2025
Wenn wir uns mit Politik befassen, dann fällt es uns meistens am leichtesten, den Bezug zu innenpolitischen Themen herzustellen, weil zum Beispiel Bildungs-, oder Sozialpolitik uns besonders unmittelbar betreffen. Du beschäftigst dich aber auch intensiv mit internationaler Digitalpolitik. Warum ist das für dich so wichtig?
Zu viele Menschen auf der Welt haben bis heute keinen verlässlichen Zugang zum Internet – und damit auch nicht zu freiem Wissen. Obwohl wir in einer vernetzten Welt leben, bleiben viele Menschen ausgeschlossen, sei es durch politische Unterdrückung, wegen fehlender Infrastruktur, mangelnder Barrierefreiheit oder teurer Geräte. Diese sogenannte Digital Divide, die digitale Kluft, ist ein globales Problem – und deshalb braucht es auch globale Lösungen.
Über Sophia Longwe

Sophia Longwe ist Projektmanagerin Politik bei Wikimedia Deutschland und arbeitet zu digitaler Infrastruktur und gemeinwohlorientierter Datenpolitik. Sie studierte Global Studies und Public Policy in Maastricht, Berlin und Austin. Beim UNESCO Global Forum on the Ethics of AI hat sie mit anderen jungen Menschen darüber diskutiert, warum es so wichtig ist, dass gerade junge Menschen einbezogen werden wenn es darum geht zu definieren: Was für KI-Anwendungen wollen wir als Gesellschaft nutzen und welche Regeln braucht es dafür. Sophias Perspektive ist im Wikimedia Europe Blog nachzulesen.
Wikipedia und das Internet sind ja keine rein deutschen Projekte, sondern globale. Es gibt Wikipedia in über 300 Sprachversionen und die deutschsprachige Wikipedia und wir als Förderverein Wikimedia Deutschland sind Teil der globalen Wikimedia Bewegung. Damit Wikipedia für alle zugänglich bleibt, müssen wir uns mit Menschen aus anderen Ländern austauschen und uns in internationalen Prozessen einbringen. Es gibt dafür ganz unterschiedliche Foren, in denen wir als Zivilgesellschaft mitsprechen – zum Beispiel beim Global Digital Compact, mit dem die Vereinten Nationen Regeln für ein sicheres und offenes Internet definieren wollen. Oder im Rahmen des Weltinformationsgipfels (WSIS). Es reicht also nicht, unsere Forderungen nur in Deutschland zu stellen – wir müssen sie auch international vertreten.
Damit Wikipedia für alle zugänglich bleibt, müssen wir uns mit Menschen aus anderen Ländern austauschen und uns in internationalen Prozessen einbringen.
Was sind denn aktuell wichtige Themen, die europäisch oder global diskutiert werden? Gibt es Gesetze oder Verträge, die aus deiner Sicht besonders wichtig sind?
Eines der großen Themen weltweit ist natürlich künstliche Intelligenz – auf EU-Ebene regelt der AI-Act den Einsatz von KI. Was viele vielleicht nicht wissen: Auch der Digital Services Act (DSA), der Plattformen reguliert, betrifft uns direkt – denn Wikipedia ist die einzige nicht-kommerzielle Plattform, die als sogenannte „Very Large Online Platform“ (VLOP) eingestuft wurde. Sie muss deshalb besonders strenge Regeln umsetzen. Diese Regeln wurden eigentlich definiert, um die negativen Auswirkungen von kommerziellen Plattformen und Social Media zu begrenzen. Damit der DSA der Wikipedia und anderen offenen und freien Projekten im Internet nicht schadet, haben wir uns auch in den Gesetzgebungsprozess eingebracht.
Politikbrief von Wikimedia Deutschland zum Digital Services Act
Dann gibt es noch technische Themen wie das Domain Name System, das bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) diskutiert wird, oder Internetstandards, die von Organisationen wie der Internet Engineering Task Force oder der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) entwickelt werden. Diese technischen Grundlagen sorgen überhaupt erst dafür, dass das Internet stabil und offen bleibt. Ohne das gibt es auch keine digitalen Wissensprojekte wie Wikipedia oder Wikidata.
Viele dieser Themen fließen aktuell in einen Prozess namens WSIS+20-Review ein. Dabei wird die Wirkung der WSIS von den Vereinten Nationen ausgewertet. Das ist eine wichtige Bestandsaufnahme, wie wir in Zukunft mit Internet-Governance, also Regeln für ein sicheres und gutes Internet weltweit umgehen wollen. Auch das globale Internet Governance Forum (IGF) wird da weiterentwickelt – das ist für uns als Zivilgesellschaft ein sehr wichtiger Ort, um mit darüber zu verhandeln, welche Regeln für das Internet gelten sollen.
Du bist Projektmanagerin für Politik bei Wikimedia Deutschland. Was haben die Themen der internationalen Digitalpolitik, die du gerade genannt hast, mit freiem Zugang zu Wissen – oder mit Projekten wie Wikipedia, Wikidata oder Wikimedia Commons – zu tun?
Ganz einfach: Es geht um die digitale Infrastruktur, auf der alles aufbaut.
Damit die Wikipedia oder andere Wikimedia-Projekte überhaupt funktionieren können, brauchen wir ein offenes, freies und global funktionierendes Internet. Ohne Interoperabilität und offene Standards wären diese Projekte nicht möglich. Internationale Digitalpolitik entscheidet also ganz konkret darüber mit, ob freies Wissen weiterhin für alle zugänglich bleibt.
Aber damit ist es noch nicht getan. Daten sind heute auch eine Form öffentlicher Infrastruktur. Wie frei Daten zugänglich sind – und damit auch für Projekte wie Wikidata oder Wikipedia genutzt werden können – hängt von deutschen, aber auch von europäischen Gesetzen ab. Deshalb setzen wir uns zum Beispiel für einen Rechtsanspruch auf Open Data ein.
Damit die Wikipedia oder andere Wikimedia-Projekte überhaupt funktionieren können, brauchen wir ein offenes, freies und global funktionierendes Internet.
Und für welche konkreten Ziele setzt sich Wikimedia Deutschland in der internationalen und europäischen Digitalpolitik ein?
Politische Entscheidungen rund um Digitalisierung betreffen nicht nur technische oder wirtschaftliche Entwicklungen, sondern ganz direkt das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Denn wir nutzen ja digitale Plattformen zum Konsumieren und Kommunizieren, wir bilden unsere Meinung im Netz, wir arbeiten mit digitalen Werkzeugen und vieles mehr. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Organisationen, die die Zivilgesellschaft vertreten, strukturell in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Wir stehen klar für einen sogenannten Multistakeholder-Ansatz: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sollen gemeinsam an Lösungen arbeiten – nicht hinter verschlossenen Türen.
Außerdem setzen wir uns dafür ein, das Internet Governance Forum (IGF) zu stärken – auf globaler Ebene, aber auch hier in Deutschland. Unsere Kollegin Friederike von Franqué ist zum Beispiel im Vorstand des deutschen IGF (IGF-D) aktiv, was uns auch national gut vernetzt.
Und noch etwas ist uns wichtig: Es braucht mehr Übersichtlichkeit in den internationalen Prozessen. Gerade zu Themen wie Künstliche Intelligenz entstehen gerade überall neue Gremien – da drohen viele Doppelstrukturen. Für zivilgesellschaftliche Organisationen, die oft mit ehrenamtlichem Engagement arbeiten, ist das kaum noch leistbar. Wir brauchen also bessere Strukturen, die auch wirklich inklusiv sind.