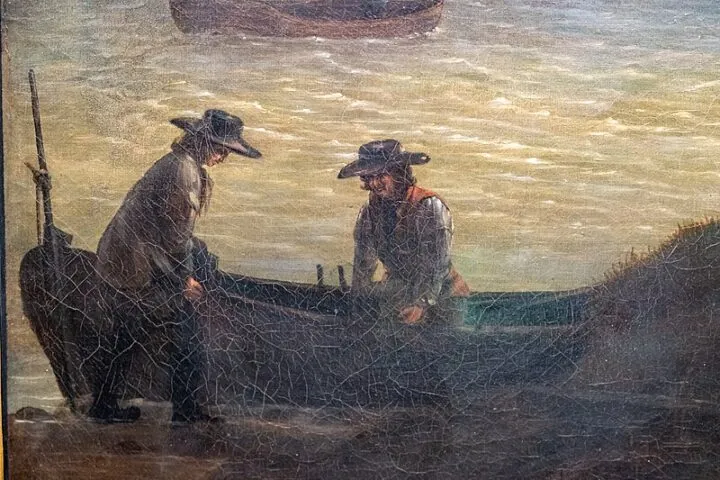GLAM digital
Wiki Loves Demokratie: Wikipedia zu Besuch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand


Patrick Wildermann
2. Juli 2025
Weltweit sehen sich Demokratien Angriffen ausgesetzt, zunehmend wird infrage gestellt, was demokratische Werte wie Meinungsfreiheit überhaupt bedeuten. Gerade vor diesem Hintergrund braucht es verlässliches und frei zugängliches Wissen. Dank der Arbeit der Wikipedia-Community existieren bereits etliche bestens ausgearbeitete Artikel zu gesellschaftspolitischen und historischen Aspekten in diesem Zusammenhang – etwa zum Begriff der Demokratie selbst oder zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Auch zur freiheitlich demokratische Grundordnung bietet die Online-Enzyklopädie einen umfassenden Überblick – ein Artikel, der in den vergangenen 12 Monaten fast 70.000 Aufrufe hatte und besonders im Kontext der Debatten um ein mögliches Verbot der AfD viel geklickt wurde.
Damit solche und viele weitere Texte stets aktuell bleiben und erweitert werden können, bringen die GLAM-Veranstaltungen von Wikimedia Deutschland die aktiven Autor*innen regelmäßig in Kontakt mit Kulturerbe-Institutionen, die bei gemeinsamen Veranstaltungen ihren Vermittlungsauftrag, ihre Sammlungen und Forschungen vorstellen, wichtige Literatur oder anderes Quellenmaterial zur Verfügung stellen – und den Wikipedianer*innen auch direkt Feedback zu bestehenden Artikeln geben.
Die Vielfalt des Widerstands
Im Rahmen des GLAM-Themenschwerpunkts „Wiki Loves Demokratie“ fand jetzt eine GLAM-digital-Ausgabe mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand statt. Angesiedelt ist sie im Berliner Bendlerblock, von wo aus am 20. Juli 1944 Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit wenigen Vertrauten vergebens versuchte, den Sturz der NS-Diktatur herbeizuführen. In Erinnerung ist der gescheiterte Plan heute als „Unternehmen Walküre“. Im Innenhof des Bendlerblocks wurde am 20. Juli 1953 mit der Enthüllung eines Ehrenmals für die Widerstandskämpfer um Stauffenberg ein Gedenk- und Erinnerungsort geschaffen, der seitdem kontinuierlich gewachsen ist.
Der Politologe und Wissenschaftliche Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW), Dr. Stefan Heinz, erläuterte in einem einführenden Vortrag den rund 20 teilnehmenden Wikipedianer*innen, wie sich die Institution entwickelt hat. Auch gegen Widerstände aus der Politik wurde hier schrittweise durchgesetzt, nicht nur den Kämpfern um Stauffenberg oder dem Hitler-Attentäter Georg Elser zu gedenken, sondern den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in seiner Gesamtheit zu würdigen – auch den von Kommunist*innen, Arbeiter*innen, durch die sogenannte Rote Kapelle, von Juden und Jüdinnen oder Jugendlichen verschiedenster Weltanschauungen. 2014 wurde auch die Dauerausstellung im Bendlerblock umfassend aktualisiert.
Vom Gedenkort zum Aufklärungsort
Die GDW habe sich von einem „Gedenkort zu einem Aufklärungsort“ entwickelt, der neben der Dokumentation auch der Forschung sowie der politischen Bildung diene und aktives Lernen ermöglichen soll, beschreibt Heinz: „Wie haben sich Menschen gegen die Diktatur gewehrt, welche Handlungsspielräume haben sie genutzt?“. Eine Frage, die nicht nur aus historischer Perspektive interessant ist, sondern wichtige Lektionen gerade für eine junge Generation bereithält. „In Zeiten, in denen Demokratien vermehrt durch Populisten und Extremisten unter Druck geraten, muss ein freier Zugang zu sachlichen Informationen jeden Tag aufs Neue verteidigt werden“, so Heinz.
In der Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit der Gedenkstätte spielt auch die Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine große Rolle – ein überparteilicher Wehrverband zum Schutz der Demokratie in der Weimarer Republik, der bis zu seinem Verbot 1933 etwa Gewalttaten der SA entgegentrat. Der Politologe widerspricht auch der These, wonach der Widerstand gegen das NS-Regime gänzlich erfolglos gewesen sei: „Zwar wurde das System nicht gestürzt, aber es gelang, wenigstens punktuell Gegenaufklärung zu betreiben und die Propaganda der Nationalsozialisten zu unterlaufen“, so Heinz. Zum Beispiel mit Flugblättern, die sich im Archiv der GDW befinden.
Impulse für die zukünftige Arbeit
Zur Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand gehören neben dem Bendlerblock noch weitere Erinnerungsorte – so die Gedenkstätte Plötzensee, die Gedenkstelle Stille Helden oder das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Der Fabrikant Weidt beschäftigte im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich blinde und gehörlose Jüdinnen und Juden, um sie vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten zu retten. Das Berliner Museum besitzt bis jetzt noch keinen eigenen Wikipedia-Artikel – ein Impuls, den die Ehrenamtlichen gern aufnahmen.
Überhaupt entwickelte sich bei der GLAM-digital-Veranstaltung ein lebhafter Austausch zwischen den Ehrenamtlichen und Stefan Heinz, der auch auf die Publikationen der Gedenkstätte Deutscher Widerstand als mögliche Quelle und Inspiration für die zukünftige Artikelarbeit verwies. Eine Schriftenreihe etwa widmet sich ausführlich dem Thema Frauen im Widerstand zwischen 1933 und 1945. „Es gibt noch vieles aufzuarbeiten“, so das gemeinsame Fazit.
Ein Gewinn für alle Seiten
„Der Austausch mit aktiven Bearbeiter*innen einer Online-Enzyklopädie zu den Themen Verteidigung der Weimarer Republik und Widerstand gegen den Nationalsozialismus war für mich Neuland“, bilanziert Stefan Heinz. „Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir bei der Veranstaltung im besten Sinne ins Gespräch gekommen sind. Die enorme Reichweite der Online-Enzyklopädie ist für Gedenkstätten besonders attraktiv, um verlässliche historische Informationen an breitere Kreise in der Gesellschaft zu vermitteln.“
Auch Holger Plickert, Referent für Kultur- und Gedächtnisinstitutionen bei Wikimedia Deutschland, freut sich über die gelungene Zusammenarbeit: „Gemeinsam wollen wir den Widerstand gegen die NS-Diktatur noch sichtbarer in den Wikimedia-Projekten machen. Die Wikipedia ist ein häufig genutzter Ort der Ersterlangung von Informationen und Wissen zu diesem Themenfeld, die gerade in Schule und Ausbildung viel genutzt werden. Umso wichtiger ist es, bei diesem sehr sensiblen Wissensbereich stets aktuelle und umfängliche Informationen in der Online-Enzyklopädie bereitzustellen.“ Dafür sei der direkte Austausch zwischen der Wikimedia-Community und den Kultur- und Gedächtnisinstitutionen unerlässlich.
In Zukunft soll dieser Wissensbereich auch mit noch mehr Bildmaterial unterfüttert werden: „Wir freuen uns hierbei sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand“, so Plickert.
GLAM digital: Die Reise geht weiter
Die Reihe „Wiki Loves Demokratie“ wird im Juli 2025 mit einem virtuellen Besuch in der Gedenk‑ und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam, einer Einrichtung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten fortgesetzt. Nach einer kurzen Sommerpause im August setzen wir die GLAM-digital-Veranstaltungen im September 2025 mit einem an den großen Fotowettbewerb “Wiki Loves Monuments” angelehnten Thema fort.