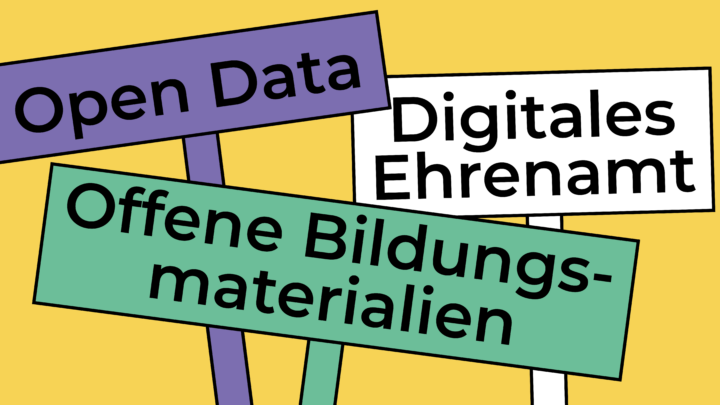Nationale Bildungsplattform
„Plattformen und Infrastrukturen bestimmen Bildung mit.“
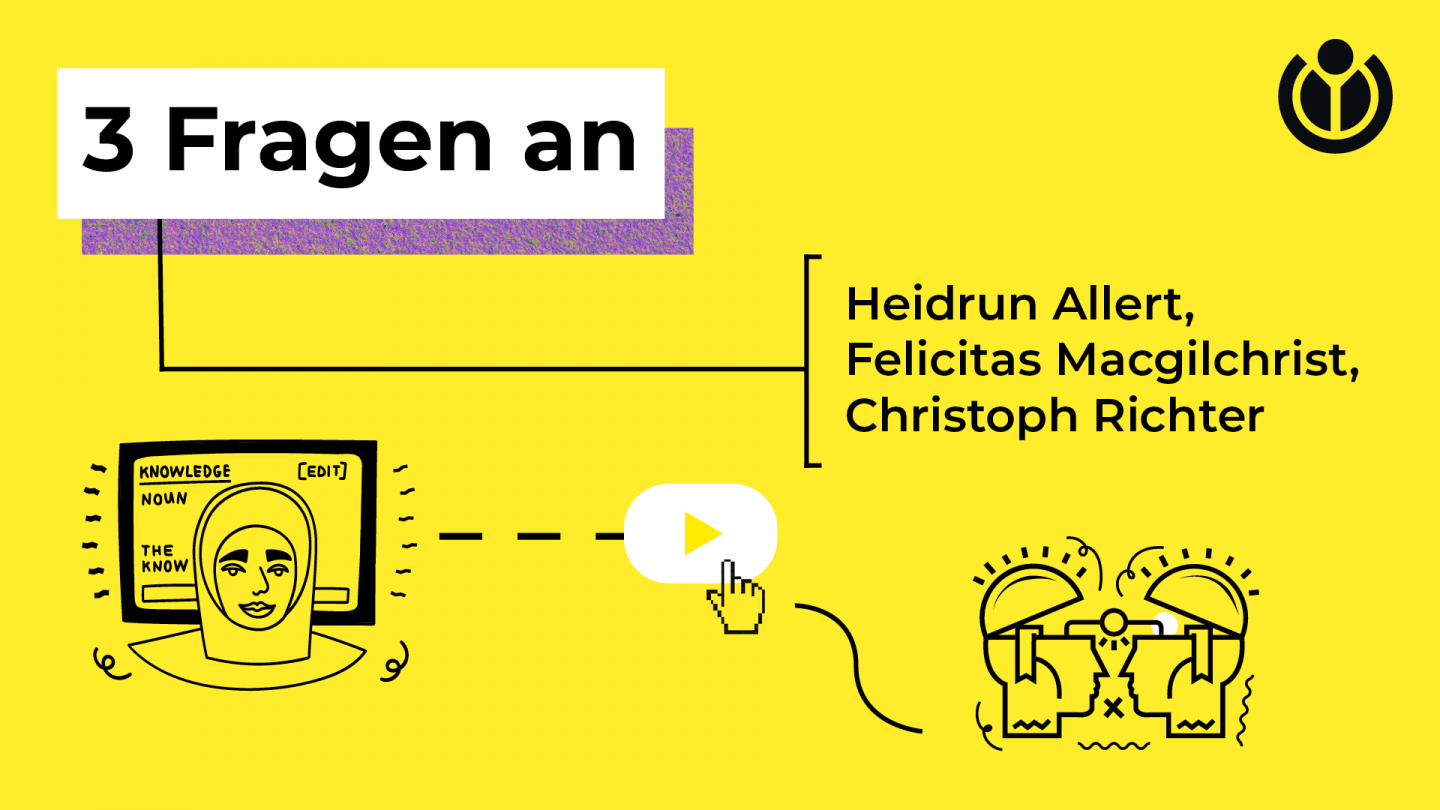
WMDE allgemein
7. Juni 2022
Wie müssen sich die Vorstellungen von Bildung verändern, damit Lernen im digitalen Raum wirklich gelingt?
FELICITAS MACGILCHRIST: Eine Antwort auf diese Frage scheint uns nur möglich, wenn wir die Digitalisierung als einen kulturellen Transformationsprozess begreifen, der nicht nur neue Formate des Lehrens und Lernens ermöglicht, sondern der in tiefgreifender Weise Einfluss darauf nimmt, wie wir mit „Wissen“ umgehen, wie wir uns zueinander in Beziehung setzen und uns selbst in der Welt verorten.
HEIDRUN ALLERT: Lern- und Bildungsangebote müssen die sich rapide wandelnden digitalen und netzbasierten Wissens- und Machtpraktiken, die unser privates, berufliches und gesellschaftliches Zusammenleben durchziehen, praktisch greifbar machen. Somit können sie auch aufzeigen, wie wir gemeinsam alternative Technologien mitgestalten können. Für die gemeinsame Einübung und Reflexion entsprechender Wissensund Datenpraktiken spielen partizipative und forschende Lernszenarien eine zentrale Rolle.
| Diesen und weitere Beiträge zur Nationalen Bildungsplattform jetzt nachlesen im Wikimedia-Politikbrief. |  |
Worin besteht das Potenzial, worin die Risiken eines so groß aufgesetzten Projekts wie der Nationalen Bildungsplattform?
CHRISTOPH RICHTER: Das Potenzial besteht darin, Technologien, Plattformen und Infrastrukturen nicht als neutral zu betrachten, sondern zu verstehen, dass sie Bildung mitbestimmen. Die Nationale Bildungsplattform bietet Anlass zu einer Diskussion darüber, wie wir uns ein zukunftsweisendes Bildungssystem vorstellen und welcher sozialen wie auch technischen Infrastruktur es hierfür bedarf. Der weite Zielhorizont des Projekts bietet dabei die Gelegenheit, auch informelle Bildungsangebote, etwa im Bereich der kulturellen und politischen Bildung, in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung anzuerkennen und strukturell zu fördern.
HEIDRUN ALLERT: Umgekehrt besteht ohne einen entsprechenden Diskurs die Gefahr, dass die Nationale Bildungsplattform dysfunktionale Strukturen des gegenwärtigen Bildungssystems nicht nur reproduziert, sondern auch verstetigt. Grundlegende Fragen betreffen hierbei etwa den Zugang zu (digitalen) Bildungsangeboten, die Rolle kommerzieller Bildungsanbieter wie auch die Überindividualisierung, Vermessung und Steuerung von Bildungsprozessen.
Wikimedia Deutschland tritt für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe aller an Bildung ein. Was muss die Nationale Bildungsplattform bieten, um dazu beizutragen?
FELICITAS MACGILCHRIST: Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe erschöpfen sich nicht im freien Zugang zu Bildungsangeboten und Lernmaterialien, sondern umfassen auch die Möglichkeit zur aktiven Mit- und Ausgestaltung der Angebote und Formate. Bildung als existenzielle Grundlage für eine demokratische, pluralistische und tolerante Gesellschaft setzt voraus, dass die Beteiligten darüber mitentscheiden können, welche Themen, Fragen und Anliegen sie im Rahmen gemeinsamer Lernprozesse adressieren wollen und in welcher Weise sie dies tun möchten. Die hiermit verbundenen Konflikte sind unumgänglicher Bestandteil dieser Prozesse.
CHRISTOPH RICHTER: Die nationale Bildungsplattform kann hierzu einen Beitrag leisten, indem sie partizipative Bildungsangebote in besonderer Weise fördert und Formate unterstützt, in denen sich die Lernenden selbst organisieren und sich ihre eigenen Lern-, Arbeits- und Forschungsumgebungen schaffen können. Die Fähigkeit zur Selbstorganisation, Teamarbeit und Kreativität darf dabei jedoch nicht vorausgesetzt, sondern muss kontinuierlich entwickelt werden.
Unsere Interviewpartner*innen
Heidrun Allert ist Professorin der Pädagogik, Schwerpunkt Medienpädagogik/Bildungsinformatik, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Felicitas Macgilchrist ist Leiterin der Abteilung Mediale Transformationen am Leibniz-Institut für Bildungsmedien und Professorin an der Georg-August-Universität Göttingen.
Christoph Richter ist Co-Leiter des Critical Data and Automation Literacy Labs und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel