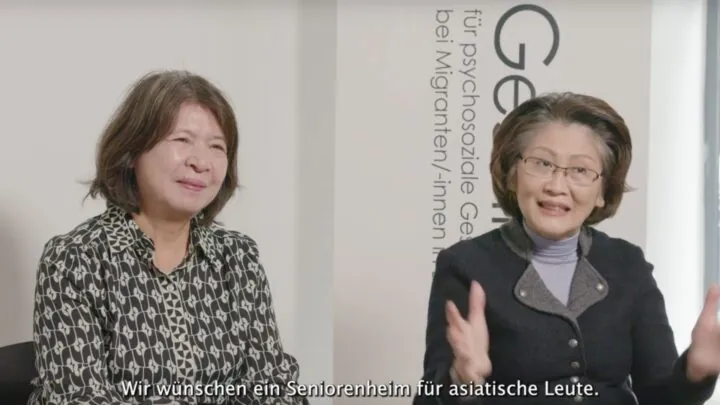Es ist ein langer Weg
WMDE allgemein
14. Oktober 2013
Über die erste Open GLAM Konferenz in Warschau.

Eng und beschwerlich ist der Weg. Hier der Abwasserkanalnachbau im Museum zum Aufstand in Warschau. By Julia Sielicka-Jastrzębska (Julia Sielicka-Jastrzębska) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Wikimedia Polska hatte gemeinsam mit verschiedenen Partnern Kultureinrichtungen aus ganz Polen eingeladen, sich gemeinsam der Frage zu stellen: Wie weit sind wir auf dem Weg zu einem offenen und freien Museum gekommen? Im Saal circa 50 bis 60 meist junge Kulturmenschen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Von einer universitären Literatur- und Kulturzeitschrift, die jüngst auch eine Online-Ausgabe gelauncht hat, einer NGO, die sich für die verbesserte Zugänglichkeit von staatlichen Werken in Polen engagiert, einem Archiv für Videoart, über eine Sammlung zeitgenössischer Kunst einer Bank bis hin zu ganz „normalen“ Museen wie dem Jüdischen Museum in Warschau oder dem Regionalmuseum aus dem schlesischen Bytom – das Spektrum war sehr vielseitig. Die diskutierten Präsentationen ergänzten Vorträge aus der Perspektive der Wikimedia-Bewegung in Polen, Schweden, Bulgarien, Deutschland sowie der Europeana. Aber so unterschiedlich die Perspektiven der Vortragenden und des Publikums im Einzelnen waren, mir blieb vor allem dieser Eindruck haften: Es ist noch ein langer Weg bis man tatsächlich von frei zugänglichen GLAM-Einrichtungen sprechen kann. Vielen ist schon der Schritt, die eigene Sammlung online zu präsentieren, damit man sie sich dort anschauen kann, ein zu gewagter. Und nach diesem ersten Schritt stellt sich rasch die Frage nach der Art der Lizenzierung. Das Videoart-Archiv glaubt, die Interessen seiner Künstler am besten durch eine restriktive Interpretation des Urheberrechtes zu vertreten. Die Banker hingegen, haben die Erfahrung gemacht, dass die Künstler, deren Werke sie für die Ausstattung ihrer Bankzentrale erworben haben, ein starkes Interesse an einer Verbreitung ihrer Werke haben. Sie haben daher nach entsprechender Beratung einer Creative Commons Lizenz zugestimmt, jedoch nur für den nicht kommerziellen Gebrauch. Das Bytomer Museum wiederum profitiert auch im wirtschaftlichen Sinne durch die Nutzung der sehr offenen CC BY – Lizenz, nach der jeder das Werk frei weiter nutzen kann auch für kommerzielle Zwecke und es verändern darf so lange er nur den Urheber nennt. Seit der Publikation ihrer Produktionen unter dieser Freien Lizenz und deren damit möglichen Online-Verbreitung ist die Anzahl der Buchungen der kostenpflichtigen Kursprogramme des Museums erheblich gestiegen. Dies stockt den knappen Etat des Museums merklich auf. In Summa: Man probiert sich und die neuen Medien aus. Das zog sich wie ein roter Faden durch die Präsentationen und Diskussionen.

Der Warschauer Kulturpalast By Marcin Białek (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Gerade der Besuch des letzten Museums hat mich sehr nachdenklich werden lassen. Ein Museum hat hier abstrakt gesprochen Daten zusammengetragen und sie durch ihre Inszenierung zu einer Aussage verdichtet. Wären wir als „User“ freier und mündiger, wenn wir freien Zugang zu eben diesen „Daten“ hätten und sie selbst zusammenstellen, gruppieren und mit unseren jeweils eigenen Fragen konfrontieren könnten? Verkürzt, versetzt uns der freie Zugang zu den Daten allein in die Lage sie zu interpretieren? Welche Aufgabe käme dem Museum in dieser Konstellation noch zu? Unter anderem dieser Frage werden wir Ende November in Berlin nachgehen. Auf der Tagung „Zugang gestalten“ werden ca. 200 Vertreter aus Kultur, Politik und Wirtschaft die Diskussion der polnischen Kollegen fortführen.
Fotodokumentation der Konferenz
Weiterer Blogbeitrag in English :)